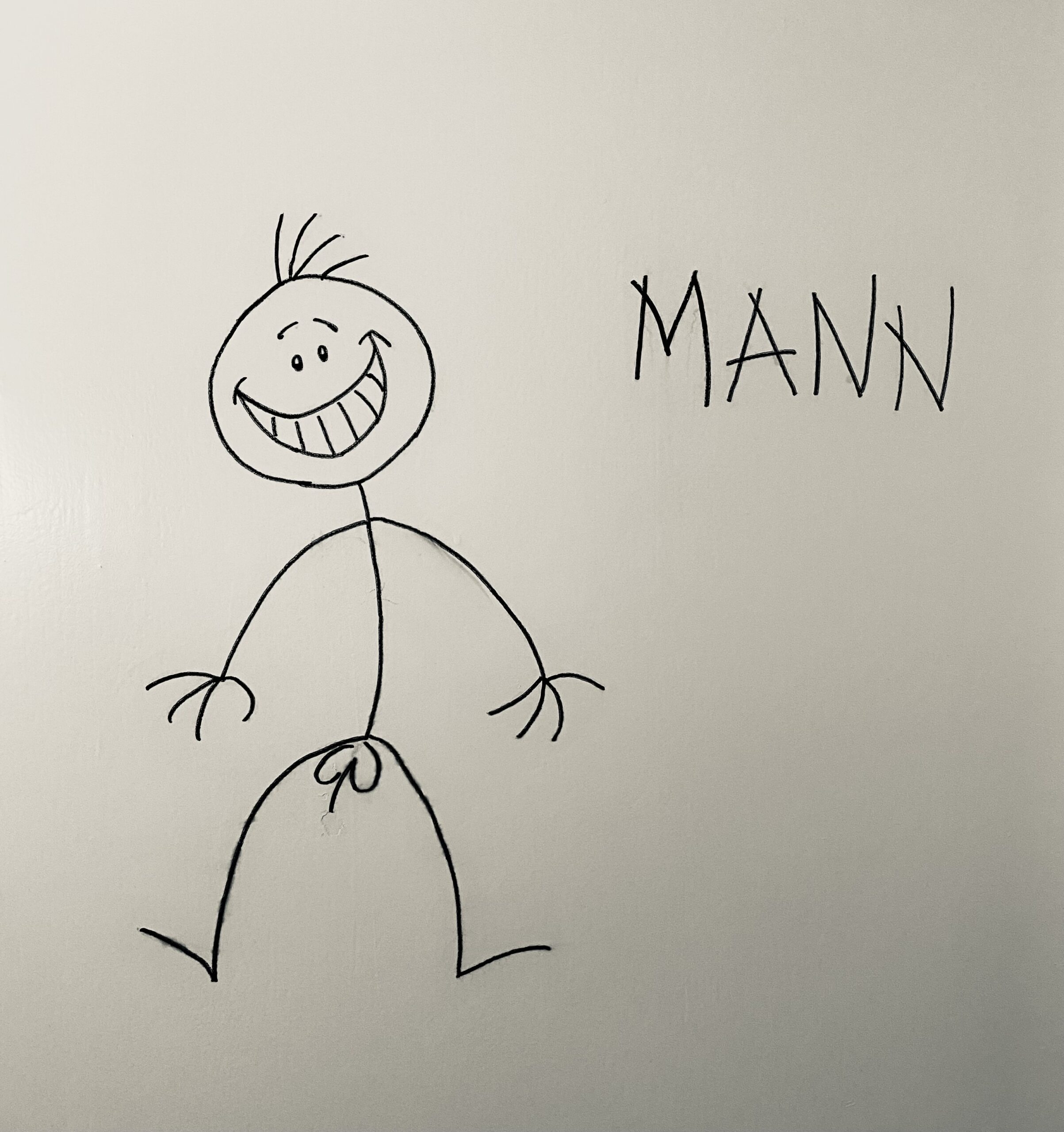Von Martin Bleif
Öffentliche Vorlesungen an Hochschulen rangieren in punkto Medieninteresse normalerweise auf dem Niveau von Veranstaltungsankündigungen des örtlichen Kleintierzüchtervereins. Nicht so ein im Juni 2022 angekündigter und dann aber „gecancelter“ Vortrag an der Berliner Humboldt Universität. Der sorgte deutschlandweit für ein heftiges Rauschen im Blätterwald. Tagelang. Die Referentin, Marie-Luise Vollbrecht, eine bis dato weitgehend unbekannte 32-jährige Doktorandin der Biologie, war – von ARD bis ZEIT – plötzlich in aller Munde. Was war passiert? Vollbrecht hatte im Rahmen einer „Langen Nacht der Wissenschaften“ für ein Laienpublikum einen Vortrag mit dem an sich unspektakulären Titel: „Geschlecht ist nicht (Ge)schlecht – Sex, Gender und warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt“ angekündigt . Vor 30 Jahren hätte sie vermutlich ihr Referat gehalten und kein Hahn hätte gekräht. Im Jahr 2022 ruft aber ein studentischer „Arbeitskreis kritischer Jurist*Innen“ zu Boykott und Protest auf, die Universität zieht den Kopf ein und sagt den Vortrag ab.
Titel sollten wir ernst nehmen: Es geht in diesem Vortrag um den Geschlechterbegriff in der Biologie, nicht mehr, nicht weniger. Es geht nicht um Geschlechterrollen, nicht um Themen wie Geschlecht und Verhalten, die in der Tat das Potential zur Kontroverse hätten. Es geht – etwas verkürzt gesagt – schlicht um den Nachweis, dass Begriffe wie Kater und Katze im Kontext der Biologe ihren Sinn haben. Warum nur produziert die Feststellung, dass es in biologischer Perspektive „zwei Geschlechter“ gibt, in unseren Tagen eine völlig überreizte Diskussion, bei der von vielen Seiten vor allem Gift und Galle hektoliterweise verspritzt werden?
Ein wesentliches Problem scheint in der Weigerung oder der Unfähigkeit zu liegen, sich auf die Bühne zu begeben, auf der die Geschichte spielt. Wenn Jurist*Innen einer Biologin, die über ihr Fachgebiet, die Biologie, referiert, ausgerechnet „Unwissenschaftlichkeit“ vorwerfen, dann müssen sie willens und in der Lage sei, sich auf die Perspektive der Biologe einzulassen. Wissenschaft arbeitet mit und vermittelt sich durch Sprache. Begriffe sind ihre Werkzeuge, die zu bestimmten Zwecken konstruiert wurden. Die Wissenschaft verwendet sie in festgelegten Kontexten und muss versuchen, sie in diesen Zusammenhängen so präzise wie möglich zu definieren. Um mitreden zu können, müssen wir versuchen, diese Definitionen zu verstehen. Ein Vorschlag zur Güte. Wie wäre es, kurz und tief durchzuatmen und zuzuhören. Sehen wir hin und denken wir nach, wie und warum der Begriff ‚Geschlecht‘ (englisch: Sex) in die Biologie gekommen ist:
Alles fing in guter alter empirischer Tradition mit einer Beobachtung an, der Beobachtung nämlich, dass die Evolution vor vielen 100 Millionen Jahren etwas Neues und bei Licht besehen Erstaunliches erfunden hat: Gemeint ist die sexuelle Form der Fortpflanzung. Für uns scheint Sex etwas Selbstverständliches zu sein, weil er bei fast allen höheren Tier- und viele Pflanzenarten die eindeutig bevorzugte Methode der Vermehrung geworden ist. Dennoch: Beim näherem Nachdenken und beim Blick auf die Geschichte des Lebens fordert die „Selbstverständlichkeit“ eine Erklärung. Denn schließlich sind die Lebewesen auf unserer Erde über 2 Milliarden Jahre auch ohne Sex gut klargekommen. Vermehrung fand in dieser Zeit (und bei Bakterien und Einzellern bis heute) höchst erfolgreich und weitaus simpler durch schlichte Zellteilung statt.
Sex ist dagegen aufwändig, kompliziert und fehlerträchtig. Schon der irische Dichter George Bernhard Shaw, berüchtigt für seine spitze Zunge, hatte implizit noch ein weiteres Problem erkannt: Auch wenn er kein Adonis war, als gefeierter und wohlhabender Dichterfürst wurde er wohl immer wieder zum Objekt weiblicher Begierde. Eines Tages machte ihm eine ebenso zudringliche wie attraktive Schauspielerin ein ziemlich eindeutiges Angebot: „Wir sollten ein Kind machen“, wisperte sie. „Stellen Sie sich vor, meine Schönheit, gepaart mit ihrer Intelligenz“. Der offensichtlich genervte Shaw konterte maliziös: „Aber was, meine Liebe, wenn es umgekehrt herauskommt und unser Nachwuchs mit meiner Schönheit und Ihrer Intelligenz ausgestattet wäre?“
Sex ist problematisch. Sex ist nicht nur verschwenderisch, weil hier zwei Eltern statt einem Elter gefordert sind, Sex gleicht – siehe Shaw – einer Lotterie, die bewährte (genetische) Entwürfe durch Vermischung zweier Genome binnen einer Generation über den Haufen werfen kann. Und doch geht es beim Sex – aus der Sicht der Biologie – genau darum: Im Kern ist entscheidend, dass zwei verschiedene genetische Entwürfe verschmelzen und dabei etwas (genetisch) Neues entsteht, ein Wesen, was eben keine (Gen)-Kopie der Eltern ist, sondern eine jedes Mal neue und einzigartige Mischung aus Genen, die zu jeweils 50 % von einem der Eltern stammen. Diese Vermischung gleicht einer Lotterie und genau dieses Zufallsprinzip ist das (evolutionsbiologisch) Erfolgsgeheimnis der sexuellen Fortpflanzung, Sexuelle Fortpflanzung setzte sich durch, weil sie die genetische Vielfalt einer Art und damit langfristig ihre Chancen im „Struggle for Live“ massiv verbessert. Wer sich nicht denken kann, warum das so ist, der kann in einem Lehrbuch der Evolutionsbiologie nachschlagen. Denn das ist nicht unser Thema.
Unser Thema ist die Definition des Geschlechterbegriffs in der Biologie. Sexuelle Fortpflanzung setzt in der Regel die Existenz zweier dafür spezialisierter Typen von Keimzellen voraus. Nur in Ausnahmefällen sind diese Keimzellen identisch aufgebaut (Isogamie). Fast immer sind sie asymmetrisch konstruiert (Anisogamie). Eine davon wird als Eizelle definiert, weil sie mit Vorräten ausgestattet ist, die in der ersten Phase nach der Befruchtung die Ernährung des neuen Wesens sichern. Der asymmetrische Partner, die Samenzelle, dringt in die Eizelle ein und bringt fast nichts mit außer ihrer Erbinformation. Bei fast allen Tierarten werden beide Kategorien von Keimzellen auch von zwei verschiedene Kategorien von Lebewesen bereitgestellt. Sexuelle Vermehrung ist also per definitionem ein Gemeinschaftsprojekt zweier asymmetrischer Kategorien von Lebewesen. Männer sind (auf dieser Ebene der Betrachtung) dadurch definiert, dass sie Samenzellen beitragen, Frauen dadurch, dass sie ihre Eizellen zur Verfügung stellen. Nicht mehr, nicht weniger.
Vielleicht wird schon jetzt der eine oder andere Protagonist der Theorie der multiplen Geschlechter ungeduldig mit den Füßen scharren und hereingrätschen wollen: Ja, aber es gibt doch Ausnahmen!!!! Die gibt es, in der Tat. Die Evolution ist unglaublich erfinderisch. Sex erfordert nicht zwangsläufig die „Vereinigung zweier Leiber“. Es existieren Tierarten, bei denen es mit der Geschlechterdichotomie tatsächlich ein bisschen komplizierter ist. Das gilt aber dann für alle Individuen der betreffenden Art. Bestimmte Wurmspezies zum Beispiel sind sogenannte „echte Zwitter“ oder – etwas distinguierter formuliert – „echte Hermaphroditen“. Echte Hermaphroditen sind in der Biologie dadurch definiert, dass sie sowohl männliche als auch weibliche primäre Geschlechtsorgane (Hoden und Eierstöcke) mit entsprechenden Keimzellen ausbilden können. Wenn Tiere gleichzeitig sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane und Keimzellen ausbilden, redet man von Simultanzwittern. Regenwürmer sind solche Simultanzwitter. In Ausnahmefällen können sie sich sogar selbst befruchten. Die genetische Lotterie der sexuellen Fortpflanzung würde in diesem seltenen Fall also tatsächlich umgangen werden. Selbst bei Hermaphroditen läuft es aber fast immer anders. Auch Plattwürmer sind echte Hermaphroditen. Sie vermeiden aber die Selbstbefruchtung. Meist lösen sie ihr Problem dadurch, dass sie im Lauf ihres Lebens ihr Geschlecht wechseln. Wenn die männlichen Gonaden zuerst reifen, dann spricht die Biologie von Proterandrie (Vormännlichkeit), im umgekehrten Fall von Proterogynie (Vorweiblichkeit). Proterandrie kommt bei Tierarten wie Plattwürmern, Ringelwürmern, Schnecken, bei Nesseltieren wie z. B. der Kompassqualle, bei Gliederfüßern und Stachelhäutern wie Seesternen vor – alles Tiere, die wir nicht gerade zu unseren nächsten Verwandten zählen. Auch einige Wirbeltierarten vollziehen eine entwicklungsbedingte Geschlechtsumwandlungen. Das gilt für manche Arten von Barschen und Meerbrassen, aber auch für Kiemenschlitzaale, Papageifische, Grundeln und Großkopfschnapper. Die Mechanismen dahinter sind vielfältig und für unser Problem nicht relevant. Relevant ist, dass artspezifischer „echter“ Hermaphrodismus eine Ausnahme darstellt. Bei den meisten Wirbeltierarten, vor allem bei Säugetieren, wird er nicht praktiziert.
An dieser Stelle sind allerdings zwei Klarstellungen angebracht:
- Begriffe wie „echter Zwitter“ oder „echter Hermaphrodit“ sind in der Biologie gut definiert. Es handelt sich um Individuen, die sowohl Hoden als auch Eierstöcke entwickeln. Umgangssprachlich wird der Begriff „Hermaphrodit“ oder „Zwitter“ oft viel weniger spezifisch verwendet. Umgangssprachlich werden nicht selten Individuen, die – aus welchen Gründen auch immer (biologischen, psychologischen oder kulturellen) – nicht eindeutig als Frau oder Mann identifiziert werden können, als Zwitter bezeichnet. Mit echtem Hermaphrodismus hat das aber meist nichts zu tun. Wenn wir über die Begriffe der Biologie streiten, dann müssen wir uns an die Definitionen der Biologie halten.
- Wir müssen drei Dinge auseinanderhalten, den artspezifischen echten Hermaphroditismus, den (sehr seltenen) individuellen (echten) Hermaphroditismus und ein uneindeutiges Geschlecht bei einzelnen Individuen einer Art, bei der die Mehrzahl der Individuen genetisch eindeutig als Frau (=Eizellspender) oder Mann (=Samenzellspender) definiert sind. Auch bei solchen Arten – wie zum Beispiel Katzen, Schimpansen oder Menschen – gibt es immer wieder einzelne Individuen, die (phänotypisch) eben nicht eindeutig der Kategorie Mann oder Frau zuzuordnen sind. Die Gründe für diese Uneindeutigkeit sind vielfältig und können auf unterschiedlichsten Ebene angesiedelt sein. Sie können in der Biologie liegen, müssen aber nicht.
Bevor ich auf individuelle, nicht artspezifische Gründe für sexuelle Uneindeutigkeit eingehe, möchte ich noch eine Sache festhalten: Anders als bei Tierarten mit einem generellen artspezifischem Hermaphroditismus gilt bei allen anderen Tierarten – auch beim Menschen: Nur weil es einzelne Individuen gibt, die – auf welcher Ebene und wodurch auch immer – nicht auf den ersten Blick eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen sind, nur weil es also Ausnahmen und Zwischenformen gibt, muss die Biologie die großen dichotomen Kategorien Mann und Frau nicht über Bord werfen. Schließlich sind die Elektro- und die Verbrennungsmotoren ja auch nicht in dem Moment von unseren Straßen verschwunden, als vor einigen Jahren auch Hybridantriebe zugelassen wurden.
In vielen (biologischen) Zusammenhängen machen diese Kategorien natürlich Sinn. Im Fall der Säugetiere hat diese Zuschreibung zum Beispiel eine wichtige Konsequenz. Hier vollzieht sich die Verschmelzung der Keimzellen im Körper der Frauen. Und sie sind es auch, die ihren Körper während der Schwangerschaft als geschützten Raum zur Verfügung stellen, in dem sich die Entwicklung von der befruchtete Eizelle bis zum lebensfähigen Individuum vollziehen kann.
Werfen wir jetzt einen kurzen Blick auf den Mechanismus, der darüber entscheidet, welches Geschlecht eine befruchtete Eizelle entwickelt. Denn auch hier war die Evolution sehr erfinderisch. Letztendlich entscheiden immer Informationen, die in den Genen angelegt sind. Was die Details der Realisierung angeht, da hat die Natur eine Reihe unterschiedlicher Wege angelegt, die aber schlussendlich alle zum selben Ziel führen, einem (genetisch – oder in Ausnahmefällen epigenetisch) eindeutig festgelegten Geschlecht. Die sogenannten ‚epigenetischen‘ Ausnahmen seien hier nur am Rande erwähnt. Es gibt einige wenige Tierarten, bei denen die Weichenstellung nicht über die Gene selbst, sondern über eine Art von (epigenetischem) Schalter erfolgt, der je nach externer Konstellation die genetische Informationen so aktiviert, dass entweder ein Männchen oder ein Weibchen entsteht. Bei Krokodilen ist es die Temperatur, die über den Modus der epigenetischen Aktivierung entscheidet, beim Clownfisch gar die soziale Umgebung. Wer das genau wissen möchte, kann in einem Biologiebuch unter dem Stichwort ‚Epigenetik‘ nachlesen. Wie dem auch sei, auch Clownfische und Krokodile sind für unser Thema eher uninteressant.
Der Stein des Anstoßes ist schließlich das Geschlecht des Menschen. Wie bei anderen Säugetieren entscheiden auch hier Gene, die auf speziellen ‚Sex-Chromosomen‘ lokalisiert sind, über das (genetische) Geschlecht. Jede der zig Milliarden Zellen unseres Körper trägt in ihrem Kern die komplette Erbinformation, codiert in über 20.000 Genen. Diese 20.000 Gene sind verpackt in 23 verschiedenen Paketen, die wir Chromosomen nennen. In allen Körperzellen sind diese Chromosomen paarig angelegt (Diploidie). (Genotypische) Männer unterscheiden sich von den (genotypischen) Frauen nur hinsichtlich des letzten, des 23. Paars. Während Frauen an dieser Stelle zwei identische sogenannten X-Chromosomen haben, finden wir im Zellkern von Männern ein X- und ein kleines Y-Chromosom.
Unsere Keimzellen aber durchlaufen in ihrer Entwicklung zwei Reifeteilungen, bei denen sie die Hälfte der Chromosomen verlieren. Die Paare werden getrennt, so dass eine reife Keimzelle vor der Befruchtung nur 23 einzelne Chromosomen beherbergt (Haploidie). Blicken wir auf die Chromosomen 1 bis 22, so bedeutet die Trennung keinen Informationsverlust, weil diese Chromosomenpaare identisch sind. Beim Chromosom 23 ist das anders. In reifen Samenzellen von Männern finden wir nach der Trennung des 23. Paars entweder ein X- oder ein Y-Chromosom. Das Y-Chromosom beherbergt nur eine Handvoll Gene, die allerdings das Zünglein an der Waage bilden. Der Zufall entscheidet, welche der beiden Samenzelltypen bei einer Befruchtung zum Zuge kommt. Ist es eine Samenzelle mit Y-Chromosom , dann wächst ein männlicher Embryo heran, bei einem X-Chromosom ein weiblicher.
Wenn wir dieser Entwicklung folgen, dann landen wir automatisch auf einer zweiten Ebene der Biologie, die oberhalb der Ebene der Gene und der Keimzellen angesiedelt ist. Wir landen beim Individuum und seinem Phänotyp. Auch auf dieser Ebene spielt der Begriff des Geschlechts eine Rolle, wird aber, je nach den Umständen, anders definiert. Zwischen der unteren Ebene, dem Genotyp, und der Ebene des Phänotyps, der sehr grob vereinfacht mit „Erscheinungsbild“ übersetzt werden könnte, bestehen natürlich Beziehungen. Trotzdem ist der Phänotyp eine schwierige Sache, weil viele seiner Aspekte nicht nur von den Genen, sondern von zahllosen weiteren Faktoren beeinflusst werden, die auf sehr komplizierte Weise zusammenspielen. Beim Menschen ist die Entwicklung des Phänotyps noch ein ganzen Stück komplexer als bei allen anderen Tierarten, weil hier neben biologischen Faktoren auch eine Vielzahl psychologischer, sozialer und kultureller Einflüsse ihre Finger im Spiel haben.
Was allerdings genetisches Geschlecht (XX oder XY) und phänotypisches (biologisches) Geschlecht bei Geburt angeht, sind die beiden Ebene zu fast 100% deckungsgleich. Soll heißen, die meisten – nicht alle – genetisch weiblichen Embryonen werden auch zu phänotypisch weiblichen Neugeborenen und umgekehrt. Spätestens an dieser Stelle muss ich eine zweite Definition nachliefern. Das phänotypische Geschlecht eines neugeborenen Menschen wird – in der Biologie und in der Medizin – durch das Vorhandenen sogenannter „primärer Geschlechtsmerkmale“ bestimmt. Primäre Geschlechtsmerkmale sind die Geschlechtsorgane, die vornehmlich der Fortpflanzung dienen. Bei der Frau wären das vor allem Eierstöcke, Gebärmutter, Vagina und Vulva, beim Mann Hoden, Nebenhoden, Samenwege und Penis. Wir reden immer noch über Biologie und über die biologischen Faktoren, die den sexuellen Phänotyp eines Neugeborenen – seine primären und sekundären Geschlechtsmerkmale – beeinflussen.
Der Weg von der befruchteten Eizelle zum Neugeborenen ist ein langer, vielstufiger und komplizierter Prozess, der neun Monate dauert und vom einem genetischen Programm gesteuert, aber auch von vielen äußeren Faktoren beeinflusst wird. In dem meisten Fällen führt dabei einen gerader Weg von den Sex-Chromosomen zum biologischen Phänotyp der Neugeborenen. Aber komplexe Prozesse haben es an sich, dass sich „Fehler“ einschleichen können. Daher gibt es auch hier Ausnahmen. Schon am Start der Entwicklung von der befruchteten Eizelle zum Neugeborenen können genetische Veränderungen vorhanden sein, die dafür sorgen, dass das phänotypische Geschlecht bei Geburt nicht eindeutig sein wird. Ich habe oben erwähnt, dass Ei- und Samenzellen im Rahmen der Reifeteilungen aus dem doppelten Chromosomensatz einen einfachen Satz machen müssen. Dabei kann es passieren, dass bei der Teilung einzelner Zellen die Chromosomen ungleich verteilt werden. Es können dann bei der Befruchtung Zellen entstehen, die ein oder gar zwei überzählige X-Chromosomen enthalten (XXY oder XXX) oder ein Y-Chromosom zu viel (XYY) oder zu wenig (XO). In der Folge entsteht ein Mensch mit einem chromosomal uneindeutigen Geschlecht. Das wirkt sich natürlich auch auf seinen biologischen Phänotyp aus. Menschen mit XXY-Konstellation (einem sog. Klinefelter Syndrom) sind phänotypisch eher Männer, haben aber sehr kleine Hoden und leiden an Testosteron-Mangel. Sie leiden an Libidoverlust, Potenzstörungen, haben spärlichen Bartwuchs, eine verringerte Muskelmasse und entwickeln oft eine Osteoporose. Menschen mit X0-Konstellation (dem sog. Turner-Syndrom) sind phänotypisch eher Frauen, aber ihre Ovarien sind verkümmert. Sie können keine Östrogene herstellen, so dass die Betroffenen unfruchtbar belieben. Ohne entsprechende Hormonbehandlung werden sie auch keine typische Pubertät entwickeln.
Bei der Entstehung der primären Geschlechtsmerkmale während der Entwicklung von Embryo und Fötus haben auch Gene ihre Hände mit im Spiel, die nicht auf den Sex-Chromosomen lokalisiert sind. Prinzipiell jedes Gen kann durch entsprechende Mutationen in einer Keimzelle ausfallen. Wenn dieser Ausfall nicht durch ein intaktes komplementäres Gene aus der Keimzelle des anderen Elters kompensiert wird oder wenn zufällige beide Eltern-Keimzellen an dieser Stelle einen Defekt haben, dann fällt dieses Gen auch beim Kind aus. Das kann harmlos sein oder fatale Folgen haben. Wenn Gene ausfallen, die für die Entwicklung des Geschlechtsmerkmale verantwortlich sind, dann können XY-Menschen bei Geburt weibliche Geschlechtsmerkmale haben und umgekehrt. Beispiele sind XY-Menschen mit einer kompletten Androgen-Resistenz (Mediziner reden auch von auch testikulärer Feminisierung, CAIS oder Goldberg-Maxwell-Morris-Syndrom). Bei diesen Menschen ist das Gen für den Androgen-Rezeptor defekt. Die Betroffenen entwickeln zwar Hoden, die auch männliche Geschlechtshormone produzieren. Diese Androgene, zum Beispiel Testosteron, können aber ihre Wirkung nicht entfalten, da sie auf ihren Zielzellen nicht an den Androgen-Rezeptor „andocken“ können. Die Hoden bleiben im Körperinnern und die äußeren Geschlechtsorgane entwickeln einen weiblichen Phänotyp. Bei Geburt deutet nichts darauf hin, dass es sich bei dem Neugeboren – genetisch betrachtet – um einen Jungen handelt. Bei Adreno-Genitalen-Syndrom ist dagegen die Bildung sogenannter Corticoide gestört, was bei genetisch weiblichen Embryonen zur Vermännlichung der äußeren Geschlechtsorgane führt. Ich könnte noch viele weitere Beispiele nennen, aber ich denke das Prinzip sollte klar geworden sein: Ja, es gibt Ausnahmen von der Regel dass das genetische Geschlecht das phänotypische Geschlecht bestimmt!
Aber auch hier gilt: Nur weil es diese Ausnahmen gibt, müssen wir die Kategorien ‚genetisches Geschlecht‘ und ‚sexueller Phänotyp‘ nicht über Bord werfen. Wenn wir sie nicht hätten, dann würden uns zum Beispiel die Vokabeln fehlen, die genannten Phänomene rund um die Fortpflanzung überhaupt vernünftig zu beschreiben. Für die Biologie ist das genetische Geschlecht keine soziale Konstruktion, sondern eine aufgrund biologischer Kriterien klar definierte dichotome Kategorie.Das gilt natürlich auch für die meisten ähnlich dichotomen primären Geschlechtsmerkmale. Die primären Geschlechtsmerkmale sind keine Dekoration. Sie haben erhebliche Konsequenzen. Sie sorgen beim Menschen zum Beispiel für klar verteilte (biologische, nicht soziale !!!!) dichotome Rollen rund um die Fortpflanzung: (Biologische) Frauen können schwanger werden und Kinder austragen, (biologische) Männer können das nicht. Die Evolution hat sich so etwas Kompliziertes wie den Sex nicht ohne Grund „ausgedacht“. Egal ob Maus oder Mensch, es sind immer dieselben biologischen Kriterien, die den Status Mann oder Frau definieren. Auf dieser Ebene, der Ebene der Gene, der reproduktiven Funktionen oder der Anatomie, über Geschlecht als soziale Konstruktion zu sprechen, ist einigermaßen lächerlich.
Nun dreht sich auch in der Biologie nicht alles um Sex. Auch unser Phänotyp besteht aus weit mehr als nur aus primären und sekundären Geschlechtsmerkmalen. Die Biologie fasst unter dem Begriff Phänotyp alle sichtbaren oder messbaren Eigenschaften eines Organismus zusammen. Dazu gehören nicht nur unser Körper, sondern auch viele Aspekte unseres Verhaltens. Und natürlich wird auch das Verhalten nicht nur vom Geschlecht und den paar Dutzend geschlechtsbestimmenden Genen, sondern von unserem kompletten Genom und unserer Umwelt und unserer Geschichte beeinflusst. Auch die Biologie braucht also weitere, „nächsthöhere“ Ebenen der Beschreibung. Die Entwicklung eines Menschen ist ja mit der Geburt noch lange nicht abgeschlossen. Sein genetisches Geschlecht und sein sexueller Phänotyp bei Geburt haben ohne Zweifel großen Einfluss auf sein weiteres Leben. Aber sie sind keine Schienen, vor denen Abweichung unmöglich wäre. Ob und wie sich genetisches Geschlecht und primäre Geschlechtsmerkmale auf unser Verhalten und die Wahrnehmung der eigenen Geschlechteridentität und Geschlechterrolle niederschlagen, das steht deshalb auf einem ganz anderen Blatt.
Die Existenz zweier biologischer Geschlechter bedeutet natürlich nicht, dass die Vorliebe für Captain Sharky oder Prinzessin Lillifee biologische Ursachen haben muss. Denn jetzt befinden wir uns nicht mehr auf der Ebene von Genen, Molekülen, Zellen oder Organen, sondern beim menschlichen Verhalten und seinen Grundlagen. Hier ist der sozialwissenschaftliche Begriff Gender zu Hause. Wenn wir über Anatomie oder Reproduktion reden, dann besteht zwischen Genotyp und Phänotyp eine ziemlich eindeutige Beziehung. Nahezu alle Menschen mit XY-Chromosomen entwickeln Hoden, mit XX-Chromosomen Eierstöcke. Wenn wir nach Korrelationen zwischen geschlechts-definierenden Genen und menschlichem Verhalten suchen, dann ist die Sache viel, viel komplizierter.
Nehmen wir zur Illustration des Problems zunächst etwas viel Simpleres als das Verhalten. Nehmen wir unsere Muskelmasse. Wenn wir zufällig 1.000 Frauen und 1.000 Männer auswählen und deren Muskelmasse bestimmen, werden wir feststellen, dass sich die Mittelwerte der Gruppen nicht-zufällig unterscheiden: Im Durchschnitt haben Frauen etwa 20% weniger Muskelmasse als Männer. Dieser Unterschied ist letztendlich genetischer Natur und leicht zu erklären. Im männlichen Kreislauf zirkulieren deutlich höhere Konzentrationen des muskelaufbauenden Hormons Testosteron.
Aber was hilft die Kenntnis des Geschlechts bei der Beurteilung eines Einzelfalls? Unter Umständen herzlich wenig. Das liegt daran, dass die Einzelwerte stark um den Mittelwert des jeweiligen Geschlechts schwanken. Es gibt sie, die männlichen Herkulesse und die zarten Damen, es gibt aber auch die umgekehrten Konstellationen. Statistiker sprechen von der Streuung oder der Varianz einer Stichprobe. Wie groß der Einfluss des biologischen Geschlechts und wie hoch die Vorhersagekraft des systematischen (statistischen) Unterschieds zwischen den Gruppen auf die Zielgröße ‚Muskelmasse‘ im Einzelfall ist, hängt nicht nur davon ab, wie sehr sich die Mittelwerte der Gruppen unterscheiden, sondern auch davon, wie stark die Werte innerhalb einer Gruppe (Frau oder Mann) um den Mittelwert streuen. Je enger die Mittelwerte beieinander legen und je flacher die Kurven verlaufen, desto belangloser wäre das Kriterium Geschlecht in diesem Zusammenhang. Dabei fällt Folgendes auf:
Erstens: Die Muskelmasse von Männern liegt im Durchschnitt (Mittelwert!) etwa 20% über dem Durchschnittswert der Frauen (Abstand der Mittelwerte m1(xx) – m2(xy)). Trotz dieser Differenz gibt es, zweitens, viele Frauen, die eine größere Muskelmasse haben als der „Durchschnittsmann“. Umgekehrt gibt es eine ganze Reihe von Männern, deren Muskelmasse unter dem Durchschnitt der Frauen liegen. Betrachten wir die ziemlich große Gruppe von Menschen (Männern und Frauen), die im den zeltförmigen Überlappungsbereich beider Gruppen liegen, dann gibt es in dieser Untergruppe gar keine statistischen Unterschiede zwischen Mann und Frau.
Warum dieses Beispiel? Die Muskelmasse ist ein realer, vergleichsweise ausgeprägter, genetisch begründeter phänotypischer Unterschied zwischen erwachsenen Männern und Frauen. Dieser Unterschied ist ausgeprägter, als fast alle anderen angeblichen oder realen geschlechtsspezifischen Unterschiede, die Affekte, Kognition oder ganz allgemein biologisch mitgeprägtes Verhalten betreffen. Das Wissen um die Mittelwerte hilft für eine Entscheidung im Einzelfall trotzdem oft nicht weiter. Wenn ich eine Waschmaschine in den Keller zu tragen hätte, würde ich eher bei Serena Williams klingeln als bei meinem leptosomen, männlichen Untermieter, der seit der Schule keine Turnhalle von innen gesehen hat.
Ich habe die Muskelmasse als Beispiel gewählt, weil es sich hier um einen relativ einfach zu ermittelnden phänotypischen Parameter handelt, auf den das genetische Geschlecht einen eindeutigen Einfluss hat. Aber selbst hier sehen wir, dass dem Einfluss der Gene Grenzen gesetzt sind. Wir sind selbst ziemlich frei, unsere eigene Positionen auf der Skala der X-Achse hin und her zu verschieben, nach rechts durch Ernährung, Training oder Doping, nach links durch Hungern und durch Inaktivität. Was für die Muskelmasse gilt, gilt in noch viele stärkerem Maße für die affektiven und kognitiven Eigenschaften und Fähigkeiten eines Menschen.
Anders als Dreiecke oder Quadrate sollten wir Individuen, auch wenn wir sie ‚Frauen‘ oder ‚Männer‘ nennen, nie als eine homogene, invariante und eindeutig festgelegte Klasse von Lebewesen betrachten. Das zeigt uns schon die Evolutionsbiologie. Menschen bilden Populationen, die aus unterschiedlichen Individuen bestehen. Das ist mehr als eine Spitzfindigkeit. Wenn wir über Unterschiede zwischen Menschen und zwischen Gruppen von Menschen nachdenken, muss klar sein, dass wir – sieht man von kategorialen, dichotomen Unterschieden wie XX oder XY-Chromosomen, Hoden oder Eierstock ab – meistens über statistische Unterschiede auf der phänotypischen Ebene reden. Diese Unterscheidung von statistischen und kategorialen, dichotomen Unterschieden ist aber offensichtlich nicht jedermanns Stärke. Bis zu dieser Stelle haben wir von der Biologie im Allgemeinen und der Biologie des Menschen geredet, vom genetischen Geschlecht, von primären und sekundären Geschlechtsmerkmalen und ihrer Beziehung zu unserem übrigen „Phänotyp“.
Wovon weder in diesem Text (noch übrigens in Marie-Luise Vollbrechts Vortrag) die Rede war, ist das weite Feld unserer subjektiv empfundenen und gelebten Sexualität. Es ging und geht hier wie dort nicht um subjektives Geschlechtsempfinden, Geschlechterpräferenzen oder um tatsächliche oder vermeintliche Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft. Vieles von dem, was wir auf diesem bunten Feld vorfinden, hat nichts mit Biologie zu tun. Natürlich steht es Menschen oder Kulturen frei, aufgrund welcher Kriterien und zu welchen Zwecken auch immer, jenseits der zwei Kategorien Mann und Frau weitere Geschlechter oder Intermediär-Formen zu definieren. Jeder von uns darf sich, soweit er das kann und möchte, von seinem biologischen Geschlecht emanzipieren. Wenn Menschen sich selbst nicht auf eine der dichotomen Kategorien ‚Mann oder Frau‘ festlegen wollen – bitte schön! Wenn Männer Männer und Frauen Frauen lieben – auch recht. Sie sind deshalb weder die schlechteren noch die besseren Menschen. Wenn Menschen ihr subjektives Empfinden und ihre objektiven Geschlechtsmerkmale nicht zur Deckung bringen, dann sollten sie – wenn sie mündig genug sind – ihren Körper ihren Empfindungen anpassen dürfen. Das alles steht außer Frage. Fast alles Wesentliche dazu steht übrigens in Artikel 3 unseres Grundgesetzes: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ Wer es noch präziser mag, kann gerne an dieser Stelle noch durch die Zusätze „wegen seines Geschlechts“ oder „wegen seiner sexuellen Identität oder sexuellen Orientierung“ ergänzen. Meine Stimme hat er. Ich vermute, dass auch Frau Vollbrecht dagegen nichts einzuwenden hätte. Das alles ist aber nicht mein Thema. Und das war auch nicht das Thema des skandalisierten Vortrags.
Und jetzt? Was ist eigentlich passiert? Ein Biologin wollte an einer deutschen Universität einem Laienpublikum den Geschlechterbegriff der Biologe erklären. So what – könnte man meinen.
Was dann aber geschah, ist mehr als ärgerlich! Zunächst viel Lärm um Nichts, der uns erspart geblieben wäre, wenn nicht die Lust am Missverstehen-Wollen zu groß gewesen wäre. Offensichtlich konnte man sich die Skandalisierung einer Banalität nicht entgehen lassen, weil der inszenierte „Pseudo-Skandal“ wieder einmal eine wunderbare Gelegenheit bot, sich selbst, der eigenen Klientel und der Öffentlichkeit zu vergewissern, dass man ohne wenn und aber – quasi a priori – „auf der richtigen Seite“ steht. Ein Sturm im Wasserglas – und trotzdem mehr als ärgerlich:
Ärgerlich, dass ausgerechnet Mitglieder einer Hochschule in ihrem heiligen, aktivistischen Eifer einen einfachen, aber fundamentalen Kategorienfehler begingen: Offensichtlich wollte oder konnte man den Unterschied zwischen wissenschaftlicher These und ideologischer Haltung nicht verstehen. Wenn ein solide gemachter Test zweifelsfrei belegen würde, dass Schwaben im Schnitt 20% dümmer sind als der Rest der Welt, dann wäre weder dieser Test noch das Ergebnis rassistisch. Wissenschaft soll beschreiben was ist. Und nicht, was – in den Augen von wem auch immer – sein sollte. Rassistisch wäre es, den Schwaben aufgrund dieses Befundes ihre Grundrechte abzusprechen.
Noch ärgerlicher, dass die kritischen Jurist*Innen der Referentin „Unwissenschaftlichkeit“ vorwarfen, ohne selbst auf dem Spielfeld der Wissenschaft anzutreten. Wissenschaftler sind keine Götter. Wissenschaft kann irren. Es liegt sogar in ihrer Natur, ihre Thesen zur Diskussion und zur Disposition zu stellen. Man muss es nur machen. Hätten wir hier schlechte Wissenschaft, dann könnte sie nur durch bessere Wissenschaft entkräftet werden, nicht durch Gebrüll.
Am ärgerlichsten ist aber, dass hier schon mal vorauseilend zum Boykott aufgerufen wurde, ohne überhaupt zu wissen, wovon eigentlich die Rede sein würde.
Mehr als ärgerlich – fast schon gefährlich – war jedoch die enttäuschende erste Reaktion der Universität, die bei schon bei geringstem Gegenwind den Schwanz eingekniffen hat und die Veranstaltung zunächst einmal einfach absagte. Dabei ist doch die Lust am der Debatte, die Freiheit von Rede und Wissenschaft, nicht nur das Lebenselixier jeder Hochschule. Die Freiheit von Rede und Wissenschaft ist die Luft, die Demokratien zum Atmen brauchen. Wie heißt es schön in Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.“
Prof. Dr. Martin Bleif ist Radioonkologe. Er war stellvertetender Klinikdirektor der Radioonkologie in Tübingen. Martin Bleif ist Autor mehrer Bücher, die beim Klett-Cotta-Verlag erschienen sind.
Lieber Leser, wenn Sie mit dem Autor in Kontakt treten wollen, um ein Feedback zu geben, senden Sie doch bitte eine kurze Mail an: mw@philab.de. Ich leite die Mail dann weiter. MW