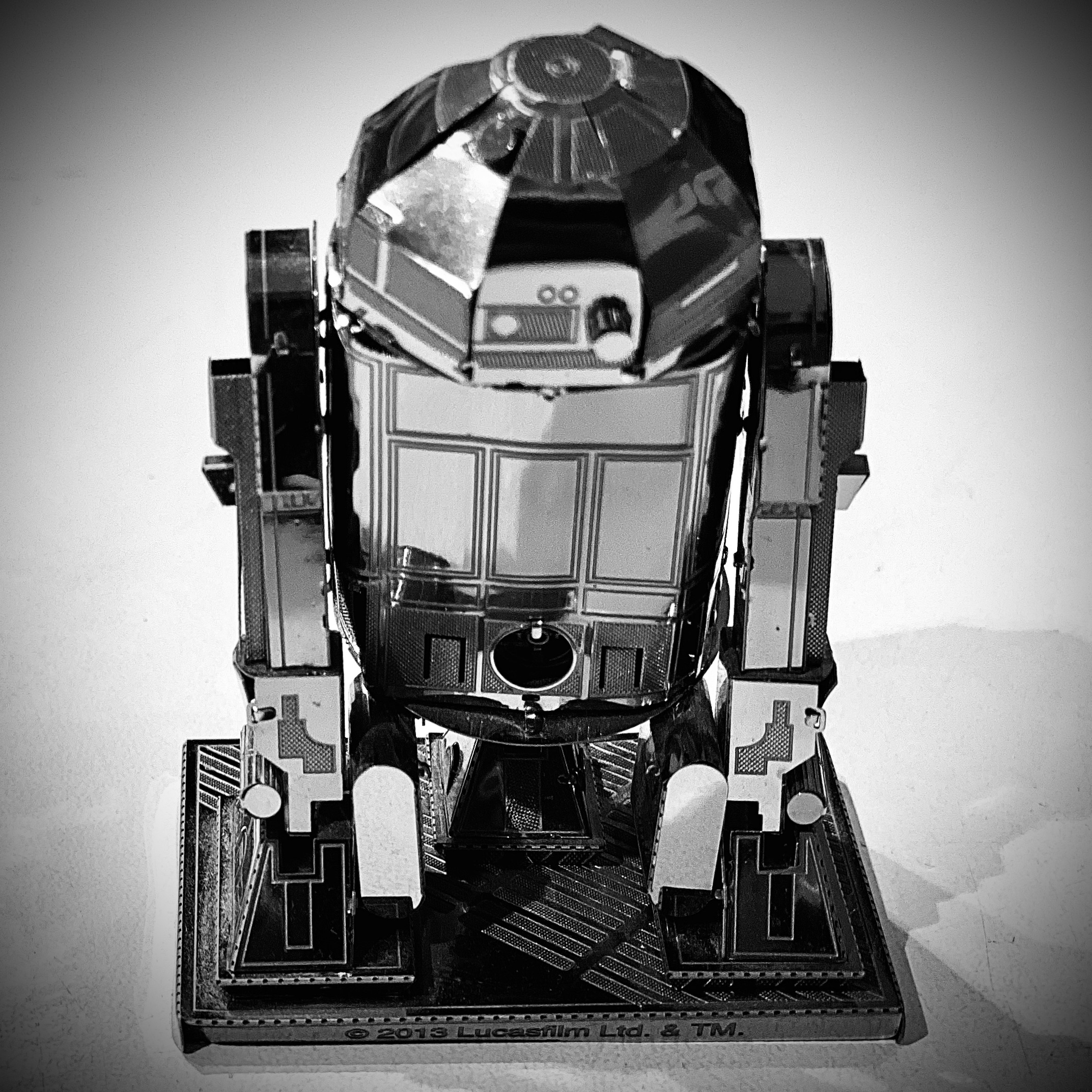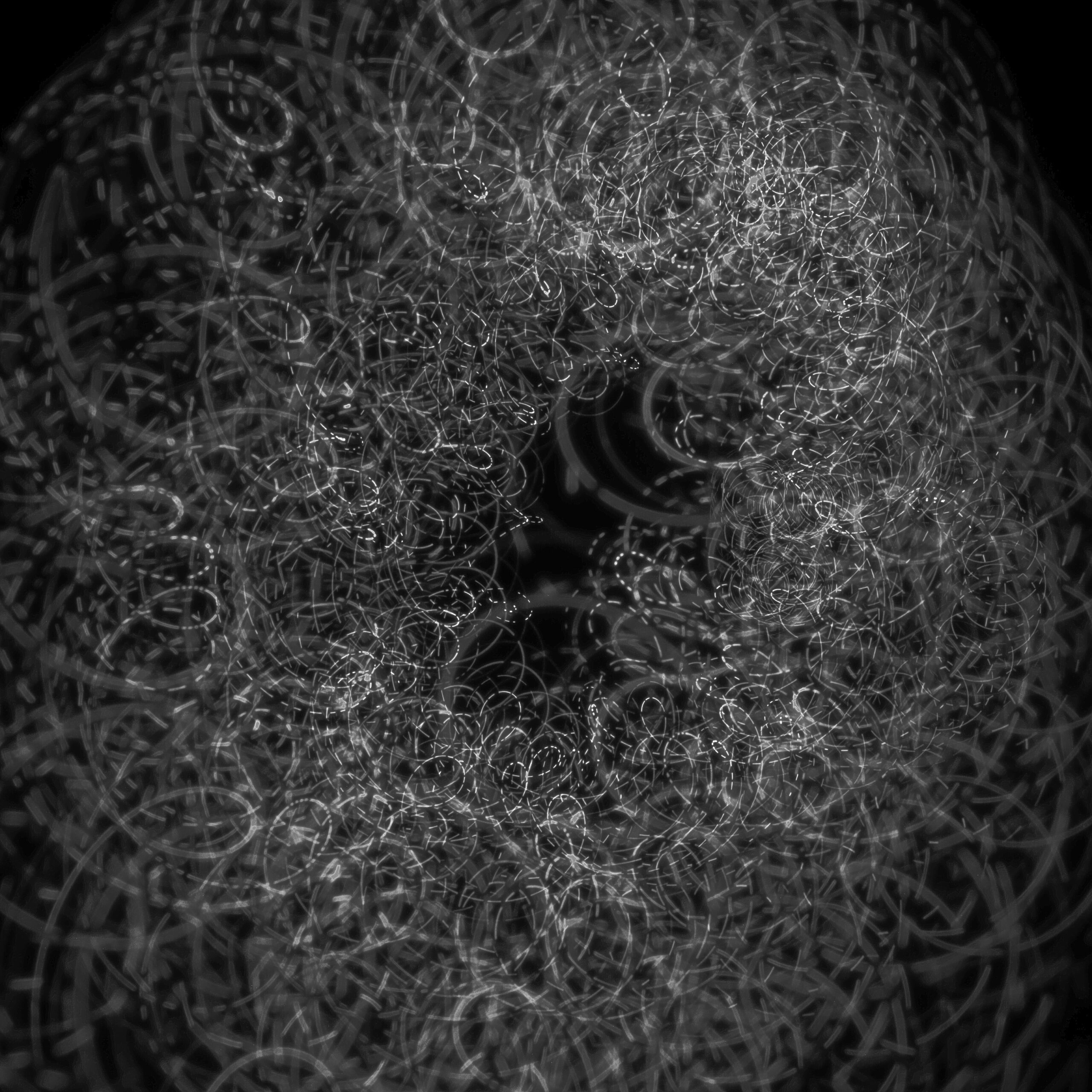Sind die Götter reif für die Rente? Glaubt man den Auguren, dann werden wir in naher Zukunft Dinge tun, die seit Anbeginn der Menschheit himmlischen Mächten vorbehalten waren: Die moderne Genetik wird uns Werkzeuge an die Hand geben, nie gesehene Kreaturen zu schaffen oder auch ausgestorbene wieder zum Leben zu erwecken. Gehirnchirurgen wie der Italiener Sergio Canavero sind fest entschlossen, menschliche Köpfe zu verpflanzen. Das ergraute Haupt eines in die Jahre gekommenen Professors auf dem jungen Körper eines im Moment zu Tode gekommenen Motorradfahrers? Am extremsten aber schießen die Spekulationen bei den Computerwissenschaftlern ins Kraut. Was halten Sie etwa von folgender Zukunftsvision?
Wenn Sie merken, dass ihr letztes Stündlein schlägt, lassen Sie sich mit Blaulicht ins Krankenhaus fahren. Dort erhalten Sie eine Vollnarkose. Das ist das Ende Ihrer biologischen Existenz. Die Chirurgen sägen Ihren Brustkasten auf und öffnen eine große Arterie. Mittels einer Pumpe flutet man Ihren Kreislauf mit Konservierungsmitteln. Gehirn und Rückenmark werden auf diese Weise plastiniert und anschließend entnommen. Mit Hilfe eines ultrapräzisen Mikrotoms wird Ihr Nervengewebe in hauchdünne Scheiben geschnitten. Solche Präzisionshobel erlauben schon heute, ein menschliches Haar der Länge nach in 2000 Scheiben zu zerlegen. Die Schnitte kommen nun unter ein hochauflösendes Mikroskop und werden mit größter Sorgfalt in einen Computer eingelesen. Unter Anwendung spezieller Algorithmen wird jedes Neuron mit sämtlichen synaptischen Verbindungen digital rekonstruiert. Dieser digitale Hirnscan – Konnektom genannt – ist nun angeblich der heilige Gral: die Essenz ihrer Persönlichkeit! Diese besteht aus Trillionen von Nullen und Einsen und wird einem Supercomputer implementiert, der in einem Roboter sitzt und diesen steuert. Was vorher tote Materie war, erwacht zum Leben und nimmt ihr Bewusstsein an. Und weil man digitale Daten ohne Verlust von einem Medium zum nächsten kopieren kann, wäre es möglich, ihr “Leben“, das mit der Existenz des Hirnscans gleichgesetzt wird, solange zu verlängern, wie es passende Speichermedien gäbe.
Glauben Sie nicht, dass es Menschen gibt, die so etwas glauben? Irrtum. In den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es eine Bewegung, die sich “Brain Preservation Foundation“ nennt. Deren Ziel ist es, durch Erhaltung der Gehirnfunktionen das Leben beliebig zu verlängern. Das gerade beschriebene Szenario halten sie für durchaus realistisch. Es muss nur noch ein wenig Zeit vergehen. In spätestens 100 Jahren sollen sogenannte Gehirn-Uploads dann so alltäglich sein wie ein Reifenwechsel beim Auto.
Man muss übrigens nicht über den Atlantik fliegen, um mit solch bizarren Vorstellungen konfrontiert zu werden. Peter Weibel, ein bekannter Medienkünstler, sinnierte in einem Interview über die Möglichkeit, sein Gehirn ins WorldWideWeb einlesen zu lassen, um dort, als digitaler Widergänger seiner selbst, weiter existieren zu können. Computernetze als virtueller Garten Eden! Vorausgesetzt, es kommt kein böses Teufelchen daher, das den Strom abstellt und die verirrten Seelen aus dem Paradies vertreibt.
Der Amerikaner Ray Kurweil, die Lichtgestalt im Reigen der digitalen Wundergläubigen, geht noch über Weibel hinaus. Kurzweil ist Chefentwickler bei Google und wird von der Community als Seher gefeiert. Ein Gehirn zu entnehmen und es in feinste Streifen zu schneiden, der sogenannte invasive Hirnscan, ist seiner Meinung nach nur eine primitive Übergangslösung. Danach kommt der nicht-invasive Scan. Die Computertomographen der Zukunft werden bei Kurzweil zu ultimativen Gedankenlesern. Mit deren Hilfe ließe sich die Seele aus dem Menschen holen. Direkt in den Computer eingespeist, würden sie als reine Information die virtuelle Welt in nie gekannter Intensität erleben. Im Vergleich mit dieser künstlichen Wirklichkeit wäre die uns vertraute reale Wirklichkeit eine freudlos-trübe Angelegenheit. Es gibt allerdings einen Wermutstropfen: Nach Kurzweil machen uns die digitalen Wundermaschinen zu einem bemitleidenswerten Auslaufmodell der Evolution. In wenigen Jahren kommt ein Schlüsselmoment – die Singularität – in dem uns die Computer für alle Zeiten intellektuell abhängen.
In vorauseilendem Gehorsam hat sich Amerika deshalb bereits eine religiöse Glaubensgemeinschaft gegründet. Deren Jünger beten Computer an, da sie angeblich schon heute eine unfassbare Intelligenz verkörpern. Aus dem goldenen Kalb ist eine schnöde Rechenmaschine geworden.
Bleibt hinzuzufügen, dass Kenner der Szene schon in sieben Jahren mit einem anderem Wendepunkt rechnen – der sexuellen Singularität. Dann werden Computer fügsame Liebesmaschinen so raffiniert zu steuern wissen, dass Frauen als menschliche Bettgenossen ausgedient hätten. Das omnipotente Orgasmodrom wird Computerfreaks jeden erotischen Wünsch erfüllen. Damit wären die Zeiten beendet, in denen sich weltabgewandte junge Männer, die in der intensiven Beziehung mit der Maschine den Umgang mit dem weiblichen Geschlecht verlernt haben, als Incels bezeichnen müssten. Das ist die englische Kurzform für “unfreiwillig zölibatär“. Hinter diesem Terminus steckt die beleidigte Haltung, dass man seltsamerweise von den Frauen nicht erhört wird. Obwohl man doch ein Prachtkerl ist. Den Frauen bliebe in diesem digital geschrumpften Mikrokosmos die Rolle der Gebärenden. Aber nur so lange, bis auch diese mit den Mitteln einer sich rasant entwickelnden Reproduktionstechnologie abgeschafft wird. Der digitale Adam bräuchte in seinem Paradies nur noch die liebevoll programmierte Maschine. Frauen wären in dieser Welt zu Exponaten für die Museumsvitrine geworden.
Man möchte hoffen, dass das überzogen ist! Aber leichte Vorbeben der sexuellen Singularität sind bereits zu spüren. So kann man sich für ein paar Dollars das Programm KARI herunterladen. Hinter dem Akronym versteckt sich eine virtuelle Freundin, mit der man eine “Beziehung“ führen kann. Man muss nur willens sein, seine Zeit mit einer auf dem Bildschirm animierten Barbiepuppe zu verbringen, die dauernd mit den Augen klimpert und Banalitäten von sich gibt.
Doch die Künstlichkeit der Dame wird durch einen Vorteil aufgewogen. Man kann ihr Aussehen und ihren Charakter mit einem Mausklick nach Lust und Laune verändern. Hatte man einen schlechten Tag, wählt man zum Beispiel die Attribute “fürsorglich und mütterlich“. Segelt man aber auf Wolke sieben durchs Leben und wäre für jeden Spaß zu haben, dann tippt man “wild und ungezügelt“ in den Computer.
Wer sich vom mittelmäßig animierten Puppengesicht von KARI nicht angesprochen fühlt, der kann sich in den digitalen Redlight-District der Berliner Firma Memento 3D einkaufen. Mit einer speziellen Brille bewaffnet schaut man einer virtuellen Pornodarstellerin dabei zu, wie sie splitternackt die Hüften kreisen lässt. Memento 3D wirbt damit, die ultimativen Stars der Branche zu lebensechten digitalen Doppelgängern zu machen. Das mag sexy aussehen, aber wirklich handfest ist das nicht. Es handelt sich eher um eine moderne Form der Tantalusqualen. Das, was man sieht und hört, kann man nicht fühlen und greifen. Die Firmenleitung hat das Problem erkannt. Es soll in Zukunft durch “Steckaufsätze“ gelöst werden, die dann die mechanische Liebesarbeit verrichten.
Frauen und Männer die schon jetzt eine härtere Gangart bevorzugen, greifen deshalb zu den Vollzugsmaschinen Rocky und Roxxxy der Firma True Companion. Die gehen als beischlaffähige Roboter direkt zur Sache. Vorausgesetzt man ist bereit, 10000 Dollar zu zahlen. Angeblich gibt es tausende von Bestellungen. Nachvollziehbar: Neben der Sinnesfreude kommt schließlich auch der intellektuelle Anspruch nicht zu kurz: Wer nach dem Liebesfest noch reden möchte, kann man mit den Robotern diskutieren. Das macht sicher Spaß. So, als würde man Kants Kritik der reinen Vernunft mit Apple Sprachsystem SIRI erörtern.
Schöne neue Welt! Auch wenn man sich mit wenig zufrieden gibt, scheint die sexuelle Singularität auch für schüchterne Computerfreaks noch ein ferner Sehnsuchtspunkt zu sein. Und vor diesem Hintergrund stellt sich dann auch die Schlüsselfrage: Welche der Visionen der digitalen Propheten haben eigentlich Aussicht, real zu werden und was ist komplett gesponnen? Lässt sich dazu heute schon etwas sagen? Werden Hyperintelligenz oder ein ewiges Leben im virtuellen Garten Eden Wirklichkeit werden?
Um uns einer Antwort zu nähern, beginnen wir mit einem Blick in die Werkstätten und Labore der Gehirn- und Computerwissenschaftler. Dort stößt man auf ein erstaunlichen Phänomen, das als “Erkenntnisparadoxon der künstlichen Intelligenz“ bezeichnet werden könnte. Es ist augenfällig, dass die Maschinen ausgerechnet in Bereichen triumphieren, die bis vor kurzem mit den höchsten geistigen Fähigkeiten des Menschen assoziiert wurden. Zum Beispiel haben selbst Schachgroßmeister heute nicht mehr die geringste Chance gegen einen Schachcomputer neuerer Bauart. Das gilt in vergleichbarer Weise auch für das komplexe Brettspiel Go. Und selbst bei der bekannten amerikanischen Quizshow Jeopardy! – übersetzt “Gefahr“ – in der Allgemeinwissen und Kombinationsvermögen gefordert sind, hat der Computer die Oberhand gewonnen. Watson, ein von IBM erschaffenes Programm, das auf den neuesten DeepLearning-Algorithmen beruht, schlug die menschlichen Seriengewinner vergangener Jahre vernichtend. Solche Erfolge bestärken weniger kritische Geister in der Überzeugung, dass die Maschinen jetzt das Kommando übernehmen – eine auch bei Intellektuellen verbreitete Vorstellung. Man denke an die Untergangsszenarien, die etwa von Stephen Hawking, Elon Musk oder Richard David Precht verbreitet wurden. Aber stimmt das? Führen uns die Roboter bald an der Leine durch den Park spazieren?
Damit kommen wir zur anderen Seite der Medaille. Von Supercomputern gesteuerte Maschinen scheitern bei banalsten Alltagsproblemen. Schauen Sie sich Videos der sogenannten DARPA-Challenge an. Das ist so etwas wie die inoffizielle Weltmeisterschaft der Roboter. Die besten ihres Faches treten gegeneinander an. Es geht darum, Dinge zu tun, die für uns Menschen trivial sind. So sollen die Roboter eine Türklinge öffnen oder in ein Auto steigen. Trotz erster ungelenker Erfolge: Die DARPA-Challenge ein Panoptikum von Pleiten, Pech und Pannen. Die Maschinen finden die Klinke nicht oder fallen auf den Rücken und stochern hilflos mit den Gliedmaßen in der Luft herum, unfähig, sich wieder aufzurichten.
Was ist da los? Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite beeindruckende intellektuelle Dominanz, die ein Schachgenie wie Gary Kasparow im Duell mit der Maschine zu einem Statisten degradiert. Auf der anderen Seite bis zur Halskrause mit kompliziertester Elektronik vollgestopfte Roboter, die, hätten sie Kleidung an, nicht in der Lage wären, unter Hemd und Pullover einen Hosenknopf zu ertasten, um ihn zu öffnen.
Das Schwierige scheint also leicht zu sein und das Leichte schwierig! Und ganz allmählich dämmert den Wissenschaftlern, woran das liegen könnte. Man hat das Problem der menschlichen Intelligenz falsch eingeschätzt! Vor etwa 50 Jahren traf sich ein Allstar-Team der Informatik in Dartmouth zu einen Sommerworkshop. Stars der Szene wie Marvin Minsky oder John McCarthy waren der Überzeugung, dass die wesentlichen Probleme menschlichen Denkens von einer intellektuellen Elite in kurzer Zeit gelöst werden könnten. Sie waren so optimistisch, weil ihnen die Schwierigkeiten des Unterfangens noch nicht einmal in Ansätzen bewusst waren. Und mit dieser Fehleinschätzung outeten sie sich unbewusst als Kinder der europäischen Geistesgeschichte. Diese ist maßgeblich von der antiken griechischen Philosophie beeinflusst und zeichnet sich durch einige bemerkenswerte Besonderheiten aus. So genießen Probleme des Alltags bei uns keine große Wertschätzung. Man denke nur an den Vorsokratiker Thales von Milet, der in den Matsch fiel, weil er gedankenverloren zu den Sternen schaute. Eine Magd lachte ihn aus und stellte die berechtigte Frage, weshalb er den Dingen, die vor seinen Füßen lägen, nicht mehr Aufmerksamkeit schenken würde. Darüber hinaus ist die westliche Philosophie im allgemeinen recht körperfeindlich. Der Körper mit seinen Bedürfnissen und Begierden ist etwas, dass den Denker von wahrer Erkenntnis abhält. Und wahre Erkenntnis wurde seit den alten Griechen häufig mit mathematischen Einsichten assoziiert: Für Pythagoras war die Welt Zahl. Platon forderte als Seinsgrund göttliche abstrakte Ideen, die wesensgleich mit geometrischen Formen waren. Und später wollte der gläubige Leibniz gleich eine allumfassende Logik entwickeln, mit der sich jedes in natürlicher Sprache formulierbare Problem mit Bleistift und Papier lösen ließe. Bleibt noch hinzuzufügen, dass Galilei der festen Überzeugung war, dass das von Gott “verfasste Buch der Natur“ in mathematischen Lettern geschrieben wäre.
In der Summe entsteht aus dieser Gemengelage eine paradiesische Weltsicht für Informatiker. Sie fühlen sich in der Überzeugung bestärkt, dass sich die Welt vom Schreibtisch aus mit ihren Rechenmaschinen erobern ließe. Dafür muss ja gewährleistet sein, dass sich die Geheimnisse der Welt in Formeln packen lassen, die von eben diesen Maschinen verarbeitet werden können. Könnte es aber sein, dass unsere philosophischen Traditionen den Blick auf die Wirklichkeit eher trüben als ihn zu schärfen? Trotz der Erfolge angewandter Mathematik, bleibt der Glaube, dass die Welt vollumfänglich kalkulierbar sei, eben nur ein Glaube! Dieser wird aber wie eine axiomatische Wahrheit gehandhabt. Das könnte ein gravierender Fehler sein. Und damit kommen wir wieder zum Alltag mit seinen Wirrnissen. Ausgerechnet viele, der für so trivial gehaltenen Allerweltsgeschehnisse, wollen sich einfach nicht in ein mathematisches Korsett zwängen lassen. Und darüber hinaus fängt man auch endlich an zu verstehen, dass der denkende Mensch nicht nur reiner Geist ist. Unser Körper ist ein notwendiger Teil des Erkenntnisprozesses.
Aber -was macht den Alltag für Informatiker denn so widerborstig? Vergleichen wir die wirkliche Welt mit einer Modellwelt! Zum Beispiel ein unaufgeräumtes Kinderzimmer mit einem Schachspiel! Die Frage, wie sich 50 verschiedene Spielsachen unterschiedlicher Form, Größe und Konsistenz, die wild verstreut im Zimmer liegen, optimal in einer Kiste verstauen lassen, ist ein Problem, dem kein Computer gewachsen ist. Dagegen ist die Modellwelt des Schachspiels genau von der Art, wie Informatiker sie lieben! Sie ist abgeschlossen, mit unterscheidbaren Zuständen und festgelegten Spielregeln. Das ist geronnene Mathematik! So lässt sich trotz der beachtlichen Komplexität des Schachspiels das Spielgeschehen mittels kombinatorischer Überlegungen in der Theorie genau fassen. Natürlich ist der Möglichkeitsraum der spielbaren Partien auch für einen Supercomputer riesig. Lässt man ihn aber die meisterlichen Partien lernen, die schon gespielt wurden, dann kann er den Raum aufgrund seiner Algorithmen sinnvoll beschneiden. In der Praxis wird er zu einem Spieler, dem kein Mensch mehr gewachsen ist.
Betrachtet man nun die Erfolge der künstlichen Intelligenz, dann fällt auf, dass es nicht selten algorithmisierbare Kunstwelten sind, in denen die Maschinen Erfolge haben. Dieser Punkt ist übrigens auch im Zusammenhang mit dem aktuellen Thema des autonomen Fahrens wichtig. Es ist kein Zufall, dass sich die Testfahrzeuge in erster Linie auf Wüstenstraßen, Flughäfen oder Autobahnen tummeln. Hier gibt es berechenbare Bedingungen, die sich für automatisiertes Fahren eignen. Ob die computerisierten Autos aber dem alltäglichen Chaos gewachsen sein werden, ist noch nicht ausgemacht. Vielleicht geht das mit viel Tamtam zelebrierte Großprojekt aus wie das Hornberger Schießen. Man denke an einen stürmischen Tag im Januar! Berufsverkehr. Heftiges Schneetreiben mit schweren, feuchten Flocken. Es ist schon dunkel. Überall nur brauner Matsch, der auf Scheinwerfern, Sensoren und Verkehrsschildern klebt. Keine idealen Bedingungen für ein allein fahrendes Auto, wenn es sich in einem mehrspurigen Kreisverkehr der Mailänder Innenstadt bewegt. Und dann vielleicht doch lieber einfach stehen bleibt.. . Ist es wirklich sicher, dass sich die Komplexität eines solchen Szenarios in algorithmisierbare Konzepte gießen lässt?
Was macht nun den menschlichen Körper für das Denken so wichtig? Wenn die virtuelle Freundin KARI oder der Lustroboter Rocky den Satz “I love you“ haucht, wissen Sie dann überhaupt, wovon sie reden? Haben diese Worte in irgendeiner Weise etwas mit den Gefühlen zu tun, die wir mit dem Begriff “Liebe“ verbinden? Nein! Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Es sei denn, Computer und Roboter hätten einen Körper, der so funktioniert wie unserer. Betrachten wir zur Veranschaulichung das Wort “Ball“! Wie kommt es zu seiner Bedeutung? Jedes normale Kind spielt mit Bällen. Sie werden gerollt, geworfen, gefangen und geschossen. Vielleicht verbinden es auch noch andere Erfahrungen damit: glückliche, schmerzhafte oder erschreckende. Es hat ein wichtiges Fußballspiel gewonnen, einen Ball ins Gesicht bekommen. Oder es wurde beinahe angefahren, als es einem Ball nachsprang, der auf die Straße rollte.
Alle Erfahrungen, die für einzelne Menschen bewusst oder unbewusst erinnerlich sind, wenn sie das Wort “Ball“ hören, machen nun dessen Bedeutung aus. Einige davon sind einzigartig. Viele aber werden mit anderen Menschen geteilt. Deshalb wissen wir recht genau, was gemeint ist, wenn von Bällen geredet wird: Wir haben vergleichbare körperliche Erfahrungen gemacht, die von wissenden Sprechern mit dem Wort “Ball“ bezeichnet wurden, weil wir vergleichbare Körper besitzen. Und weil wir in vergleichbarer Weise mit Bällen gespielt haben. Daraus ergibt sich in der Summe eine Schnittmenge sensorischer und motorischer Erfahrungen. Und diese macht Kommunikation zwischen uns Menschen möglich . Zumindest bei elementaren Ankererfahrungen. Mit komplizierteren Wörtern wie “Liebe“ wird das bekanntlich schwieriger, da die prägenden Erfahrungen sehr unterschiedlich sein können. Das macht schmerzhafte Missverständnisse zwischen Menschen möglich.
Ein Roboter, dessen “Körper“ eine völlig andere Sensorik und Motorik hätte, würde andere Erfahrungen machen, die schwerlich mit den menschlichen vergleichbar wären. Und wenn er wie ein Mensch Begriffsbildungen vornehmen würde, dann hätten die Worte eine ganz andere Bedeutung für ihn. Das schließt übrigens nicht aus, dass kluge Maschinen untereinander irgendwann eine eigene Sprache entwickeln könnten, die sie miteinander sprechen. Die Bedeutung des Gesprochenen wäre aber von menschlicher Sprache verschieden. Vor diesem Hintergrund ist deshalb eine gelingende Kommunikation zwischen Mensch und Maschine schwer vorstellbar.
Was aber machen nun die “sprechenden Maschinen“, die wir schon kennen? KARI und Rocky oder SIRI und ALEXA? Diese Systeme konstruieren keine Bedeutung, wie wir das tun! Sie nutzen vor allen Dingen statistische Korrelationen. Dazu müssen sie ausdauernd trainiert werden. Man füttert sie mit Miriaden von Beispielsätzen die im Internet zu finden sind. Wenn Sie dann “Was ist die Hauptstadt von Deutschland?“ hören, dann folgern sie “Berlin“. Ohne allerdings im geringsten zu wissen, was wir mit dem Wort “Berlin“ verbinden. Diese Bedeutungsblindheit wird solchen Sprachsystemen auch in Zukunft erhalten bleiben. Deshalb wird kein Liebesroboter den Traum vom einfühlsamen Dialog erfüllen. Er ist und bleibt eine Vollzugmaschine. Schlechte Karten für die sexuelle Singularität.
Nehmen wir jetzt den digitalen Hirnscan ins Visier! Auch hier bleibt die Rolle des Körpers unverstanden. Wir erinnern uns: Es wird behauptet, dass man die Funktionsweise eines Nervennetzes vollständig verstanden habe, wenn man exakt angeben kann, in welcher Weise die Neuronen miteinander verschaltet sind. In dieser Sichtweise wäre das Konnektom so etwas wie das Wesen des Menschen. Ließe sich dieses Wissen digitalisieren, sollten moderne Formen der Seelenwanderung und das Existieren im digitalen Garten Eden möglich werden. Herr Kurweil lässt schön grüßen. Aber macht das Sinn?
Das darf bezweifelt werden. Schon die fundamentale Behauptung, man könne auf der Grundlage des Konnektoms auf die Funktionsweise eines komplexen Nervensystems und damit auch auf das Verhalten schließen, ist fragwürdig. Eine solche Behauptung ist etwa so sinnvoll, als würde man vorgeben zu wissen, wie die Züge fahren, wenn man das Streckennetz der Bundesbahn aus der Luft mit einer Drohne abfotografiert. Diese Information ist unvollständig, solange nicht bekannt ist, wie schnell die Züge sind, wo sie fahren, wie lange sie halten und wie die Weichen gestellt sind. Wie naiv die Gleichsetzung von Konnektom und menschlichem Wesen ist, lehrt uns übrigens ein kleines Würmchen, das auf den Namen C. elegans hört.
Von diesem Tierchen kennt man jedes Neuron und alle synaptischen Verbindungen seines Nervensystems. Das alles kann man in den Computer eingeben. Aber gelingt es wie erhofft, das Verhalten des Wurms in der Simulation zu imitieren? Nicht wirklich – zur großen Enttäuschung der Forscher. Bei Lichte besehen ist das aber nicht verwunderlich. Jedes Konnektom ist schließlich nur eine Momentaufnahme im Leben eines Individuums! Könnte man vorhersagen, wie ein Film weitergeht, wenn man nur ein Bild betrachtet, das man von der Leinwand abfotografiert hat? Natürlich nicht. Und genauso ist es mit Lebewesen. Jedes Nervennetz ist ein hochgradig dynamisches System, das sich permanent verändert und zwar in der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt, in der es sich bewegt und Erfahrungen macht. Dieser Umbauprozess ist viel komplexer, als es den Informatikern lieb ist. Er umfasst zum Beispiel auch die genetisch gesteuerte Produktion bestimmter Transmittermoleküle, die für die Signalübertragung zwischen Neuronen notwendig sind. Damit müsste aber auch dieser Prozess simuliert werden. Und damit hätte eigentlich das gesamte Tier mit seinem Köper Gegenstand der Simulation zu sein, da sich das Nervensystem in Wechselwirkung mit dem Körper verändert. Das allerdings ist unmöglich. Und was beim Wurm nicht funktioniert, das funktioniert dann beim wesentlich komplexeren Menschen schon einmal gar nicht.
Auch die phantastisch klingende Idee, dass der Hirnscan eines Menschen, der einem “Roboter“ eingepflanzt worden ist, als “Ich“ in der Maschine weiterlebt, vernachlässigt, dass Hirn und Körper ein sich permanent veränderndes Wechselwirkungsgeflecht sind. Warum? Betrachten wir zur Veranschaulichung die Kopfverpflanzung, die der Gehirnchirurg Sergio Canavero plant. Was würde passieren, wenn man den Kopf des Lebenden auf den toten Körper verpflanzt! Bekommen wir einen Menschen, der sich freut, ein neues Leben erhalten zu haben? Vielleicht im ersten Moment! Aber was dann geschieht, könnte einem Horrorfilm entnommen sein. Es ist nämlich ziemlich wahrscheinlich, dass sich die Identität des Menschen vollständig verändert. Dann wäre allerdings nicht mehr klar, was gemeint ist, wenn er “Ich“ sagt. Warum?
Der gesamte menschliche Körper ist im Gehirn kartiert, also abgebildet. Wenn der Körper nun ein anderer ist, wird sich auch das komplette Gehirn mit nicht absehbaren Folgen umorganisieren! Der Mensch wird nicht derselbe bleiben. Und jetzt kommen wir zurück zum Roboter. Dieser Umbildungsprozess wäre noch extremer, wenn wir einen Maschinenkörper hätten. Von dem, was wir als unser Wesen betrachten, bliebe nichts mehr übrig.
Atmen wir einmal durch! Wir merken, dass es anspruchsvoll ist, über die Zukunft der künstlichen Intelligenz nachzudenken. Obwohl wir hier nur einen Teil der möglichen Szenarien hinterfragt haben, ist aber deutlich geworden, dass viele Visionen der digitalen Propheten offensichtlich Luftnummern sind. Das schließt natürlich nicht aus, dass uns die Maschinen, wie heute schon im Schach oder Go, in anderen Bereichen überflügeln werden. Aber welchen? Dazu müssen wir gewissenhaft nachdenken, um das Mögliche vom Unmöglichen zu trennen. Es bleibt also spannend..