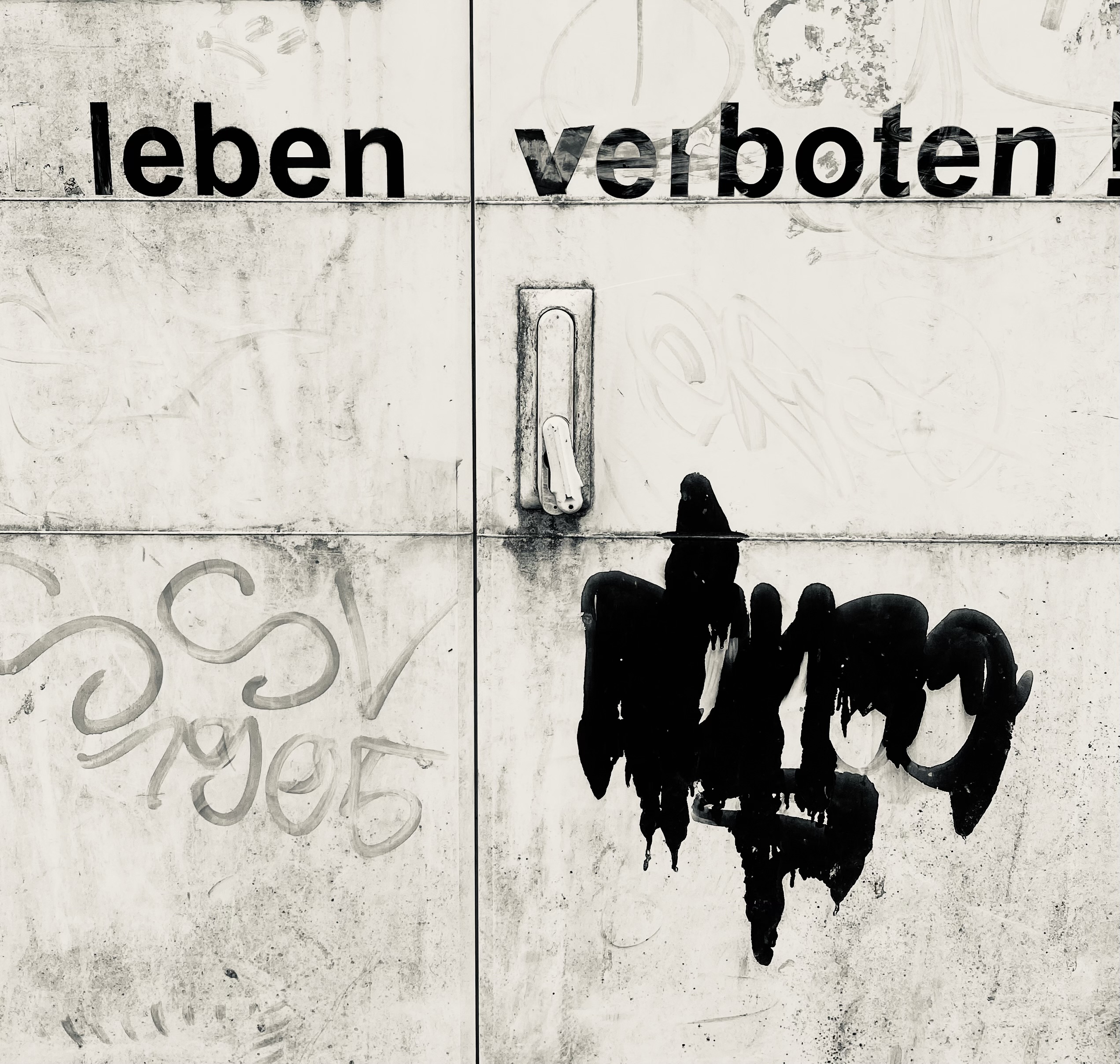In Deutschland steht die Energiewende ganz oben auf der Agenda. Aber ist der deutsche Ansatz auch effektiv? Werden die Gelder dort eingesetzt, wo Sie den größten ökologischen Nutzen generieren? Das darf bezweifelt werden. Zeit zum Umdenken
Eine Kritik von Marco Wehr
Es hätte ein entspannter Abend sein können. Die junge Familie saß auf der Terrasse eines thailändischen Restaurants in der Tübinger Belthlestraße beim Essen, als der Vater ein Auto hörte, das nach seinem Gefühl zu rasant beschleunigte. Der 35-jährige Mann sprang auf, ergriff einen Stuhl und stellte sich auf die Straße, um den vermeintlichen Temposünder zum Anhalten zu bewegen. Als dieser es wagte, ihn zu umfahren, verpasste er dem Renault Clio mit dem Metallstuhl einen kräftigen Hieb. Die hintere Scheibe zersplitterte und die B-Säule wurde beschädigt. Es kam zum Gerichtsverfahren. Die Richterin bezichtigte den Mann der Selbstjustiz. Aber dieser zeigte keine Reue. Er sei ein moralischer Avantgardist mit einem Master in nachhaltiger Mobilität. In naher Zukunft würden die meisten Menschen sein Verhalten für normal halten.
Nur hundert Meter weiter, im Schlossbergtunnel, kam es vor Jahren zu einem ähnlichen Vorfall. Der Tunnel wurde ursprünglich von Fußgängern, Rad-, Mofa- und Mopedfahrern gleichermaßen genutzt, bis Oberbürgermeister Boris Palmer die motorgetriebenen Fahrzeuge aus diesem verdammte. Ein Tübinger Medizinprofessor wollte Sinn und Zweck dieser Maßnahme nicht einsehen. Er wagte es, den Tunnel mit seiner kleinen Tochter auf einem Motorroller zu durchfahren. Das fand das Missfallen eines Fahrradfahrers, der Mädchen und Professor ins Gesicht spuckte.
In beiden Fällen irritiert die Selbstgerechtigkeit der eingebildeten Umweltschützer und diese ist noch nicht einmal durch Fakten gestützt. Auf die Frage der Richterin, wie der Angeklagte sicher sein konnte, dass das Auto so schnell gewesen wäre, entgegnete der Mann, dass er Geschwindigkeit mit den Ohren erkennen könnte. Er hätte lange als Pizzakurier gearbeitet und wüsste deshalb, wovon er redet. Mit ein bisschen Physik, einem Blatt Papier und einem Bleistift in der Hand, hätte man allerdings zeigen können, dass die Version des Angeklagten, so wie sie in der lokalen Presse zu lesen war, wenig plausibel war. Und der Professor rechnete genüsslich aus, dass auch der Palmersche Bann mit Umweltschutz nichts zu tun hat.
Ein Zigarettenraucher, der völlig legal mit der Kippe in der Hand durch den Tunnel schlendert, emittiert gemäß seiner Rechnung mehr gefährliche Schadstoffe als ein Junge auf seinem Töff-Töff, der nun, auf dem Weg zur Schule, zu einem kilometerlangen Umweg gezwungen wird, was der Umwelt schadet.
Man begegnet in diesen skurrilen Geschichten also einer als Rationalität getarnten Irrationalität, selbst wenn man von der moralischen Selbsterhöhung der Protagonisten absieht. Ist diese ökologische Irrationalität nur auf vereinzelte Fanatiker beschränkt, die über das Ziel hinausschießen? Nein, diese ist weiter verbreitet als man denkt, auch wenn sie nicht immer so plakativ daherkommt, wie in den genannten Beispielen. Die ökologische Bewegung, vertreten durch die Partei der Grünen aber auch durch die einst großen Volksparteien, hat zwar dir richtigen Ziele, wendet aber nicht immer die wirkungsvollsten Methoden an, um sie zu erreichen. Das gilt im Kleinen wie im Großen. Gut gemeint, ist nicht zwangsläufig gut gemacht.
Bleiben wir einen letzten Moment in Tübingen und ziehen die Blende etwas weiter auf, dann könnte auch die unlängst geplante Stadtbahn als Beispiel dienen. Für dieses hart umkämpfte Prestigeprojekt, das durch einen Bürgerentscheid gestoppt wurde, hätten 280 Millionen Euro in die Hand genommen werden müssen. Gespart hätte das Mammutunternehmen etwa 6000 Tonnen CO2 im Jahr. Ist das viel? Es mag überraschend klingen: Würden die Tübinger den Luftdruck ihrer Autoreifen regelmäßig prüfen und beim Einseifen unter der Dusche das Wasser abstellen, ließe sich dieselbe Menge CO2 vermeiden. Diese Maßnahmen kosten nichts. Wäre das umkämpfte Vorzeigeprojekt also sein Geld wert? Daran darf man Zweifel hegen. Ganz prinzipiell sollte man nicht vergessen, dass der Klimawandel ein globales Problem ist. Es geht nicht darum, dass Tübingen das Wettrennen um die erste klimaneutrale Stadt gewinnt, egal, was es kostet.
In vergleichbarer Weise darf man die Frage stellen, ob die gigantischen Summen, die in die deutsche Energiewende gesteckt werden, sinnvoll investiertes Kapital sind. Man mache sich bitte einmal die Dimensionen klar! Die deutsche Energiewende ist schon heute das größte Infrastrukturprojekt der BRD nach dem zweiten Weltkrieg.
In der Summe werden Billionen von Euro investiert werden. Hilft dieses Geld den globalen CO2-Ausstoß merklich zu reduzieren? Das Zwischenergebnis stimmt nicht optimistisch. Bis dato ist die Energiewende wenig effizient. Bei der CO2-Vermeidung dümpelt Deutschland im europäischen Mittelfeld. Zu allem Überfluss haben wir mittlerweile den höchsten Strompreis der Welt, eine extreme Belastung für Industrie und Privathaushalte. Sind wir trotzdem auf dem richtigen Weg?
Diese Frage kann nur beantwortet werden, wenn eine andere geklärt wird:
Wie muss man eigentlich die vorhandenen finanziellen Mittel einsetzen, um so effizient wie möglich den CO2-Ausstoß zu minimieren?
Diese zentrale Frage ist leicht zu verstehen. Aber sie birgt Abgründe.
Um diese auszuloten, setzen wir uns zuerst mit dem Begriff der Effizienz auseinander. Effizient wird gehandelt, wenn man mit den vorhandenen Mitteln, das Optimum herausholt. Man stelle sich zur Veranschaulichung eine Mutter und ihre Kinder in einer Hungersnot vor. Die Mutter hat 100 Euro zur Verfügung, um Nahrungsmittel für sich und ihren Nachwuchs zu kaufen. Wäre es effizient, das Geld in ein Rinderfilet zu investieren, das überteuert auf dem Schwarzmarkt erworben wird? Oder wäre es klüger, preiswerte, hochkalorische Lebensmittel, wie Linsen, Reis oder Nudeln zu kaufen? Die Antwort liegt auf der Hand.
Vergleichbar ist es in der Umweltpolitik. Verantwortlich wird nur da gehandelt, wo das Geld betreffs des Klimawandels eine möglichst große ökologische Wirkung entfaltet. Dabei muss noch betont werden, dass die verfügbaren finanziellen Mittel immer endlich sind. Daraus ergibt sich eine wichtige Schlussfolgerung: Das Geld, das man für wenig effiziente Maßnahmen ausgibt, fehlt, um die wirkungsvollen zu finanzieren! Damit stellt sich die nächste wichtige Frage: Was sind wirkungsvolle Maßnahmen? Um zu einer Antwort zu gelangen, müsste man eine valide Priorisierung vornehmen. Wo wird in den nächsten Jahrzehnten am meisten CO2 emittiert werden und wie könnten wir effizient intervenieren? Weicht man der Beantwortung dieser Frage aus, kann man das Klimaproblem definitiv nicht lösen. Deshalb sollte sie im Zentrum der öffentlichen Diskussion stehen. Tut sie aber nicht. Einige wenige Spezialisten zerbrechen sich die Köpfe, aber im medialen Diskurs ist sie eigentlich nicht existent. Und als handlungsleitender Gegenstand deutscher Politik fungiert sie ebenfalls nicht.
Zwar wird manchmal resigniert darauf hingewiesen, dass die beiden größten CO2-Emittenten China und die USA sich immer wieder um verbindliche Reduktionsziele drücken, weshalb Europa respektive Deutschland eine Vorbildfunktion zukommen muss. Ein zentrales Problem wird in diesem Zusammenhang aber beharrlich ausgeblendet. In etwa 30 Jahren werden 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben! Besonders Indien und Nigeria wachsen schnell. Überschlägt man den Energiebedarf der Menschheit im Jahre 2050, wird zusätzlich die Energie benötigt, die dem Output von 20000 – 40000 Kohlekraftwerken entspräche. In Deutschland klopfen wir uns auf die Schulter, weil wir planen, 100 Kraftwerke vom Netz zu nehmen.
Bekämpfen wir denn nun in Deutschland, sieht man erst einmal von globalen Überlegungen ab, effektiv den Klimawandel? Dazu werfen wir einen genaueren Blick auf unsere Energiewende! In deren Zentrum steht ein öffentlich wenig hinterfragtes Paradigma: Die Erneuerbaren müssen ausgebaut werden, koste es was es wolle. Das macht uns angeblich unabhängig von Gas-, Kohle- und Atomkraftwerken. So klingt es unisono aus den Mündern grüner Leitgestirne wie Luisa Neubauer oder Robert Habeck. Selbst Szene-Philosoph Richard David Precht bläst in dasselbe Horn. Das scheint im ersten Moment auch einzuleuchten. Windräder und Sonnenkollektoren haben schließlich keinen Schornstein, aus dem dreckige Luft herausquillt. Aber das blütenweiße Image bekommt schnell Flecken, wenn man hinter die Kulissen guckt. Winde und Sonne sind schließlich unstete Gefährten. Man sollte sich genau überlegen, ob man sich ihnen auf Gedeih und Verderben anvertrauen will.
“Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist“, sagt schon der Volksmund, der damit in metaphorischer Weise der Chaostheorie vorgreift. Diese belegt, dass das Wetter ein schon mittelfristig nicht verlässlich zu prognostizierendes Phänomen ist. Das ist aber schlecht, wenn man nur mit den Erneuerbaren den steten Energiehunger eines Industrielandes stillen will. Tatsächlich besteht massiver Handlungsbedarf, wenn es dunkel und windstill ist. Das ist dann der heimliche Auftritt der öffentlich Geschmähten: Vor allem Kohle, Gas und Uran liefern den fehlenden Strom. Täten sie es nicht, hätten wir ein ernstes Problem.
Leider verhagelt uns das dann in der Konsequenz die CO2-Bilanz. Noch immer werden in Deutschland für eine Kilowattstunde Energie etwa 500 Gramm CO2 in die Atmosphäre gepustet. Im Gesamtzusammenhang gesehen, haben Windräder und Solarpanele bis zum heutigen Tage also doch einen Schornstein, auch wenn man ihn nicht direkt sieht. Und Elektroautos, die diesen Energiemix tanken, haben einen Auspuff. Weshalb diese trotzdem hartnäckig als Null-Emissionsfahrzeuge bezeichnet werden, bleibt das Geheimnis deutscher und europäischer Politik.
Wir halten fest: Die deutsche Energiewende ist bis jetzt nicht nur wenig effizient, sie ist auch extrem teuer, da der Kraftwerkspark sozusagen in doppelter Ausführung vorliegen muss. Außerdem gibt es zu denken, dass die absolut zentrale Frage, wie die vorhandenen Mittel eingesetzt werden müssten, um möglichst effektiv gegen den globalen Klimawandel vorzugehen, öffentlich nicht ernsthaft diskutiert wird.
Dass die momentane Situation unbefriedigend ist, wissen natürlich auch die Protagonisten der Energiewende. Doch gemäß ihrer Überzeugung gibt es eine Lösung: Man bräuchte ja nur genug Speicher zu bauen, dann wäre das Problem erledigt. Dann könnten diese bei Dunkelflaute in die Bresche springen, wenn sie vorher mit überschüssigem Strom geladen worden wären, den sie dann wieder ins Netz speisten. Die Dreckschleudern wären überflüssig. Das klingt erstmal nach einer guten Idee. Welche Speicher kämen dafür in Frage?
Obwohl der Wettstreit um die effizienteste Technologie eigentlich noch gar nicht wirklich begonnen hat, wurde auch hier schon eine paradigmatische Entscheidung getroffen. Der grüne Wasserstoff soll es richten. Andere Möglichkeiten werden kaum oder gar nicht diskutiert. Ist das klug und der Komplexität des Problems angemessen?
Wieder lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Wir unterscheiden zum besseren Verständnis zwei unterschiedliche Speicherphilosophien. Betrachten wir zuerst die bekannten Erdgasspeicher! In diesen Speichern können gigantische 230 Terawattstunden Energie gespeichert werden. Es muss betont werden, dass deren Füllstand allein vom Zu- und Abfluss des Erdgases abhängt. Sie sind deshalb von den Leistungsschwankungen der Windräder und Solarpanele entkoppelt. Aus diesem Grund werden sie hier als nicht-volatile Speicher bezeichnet.
Im Gegensatz dazu nutzen volatile Speicher anfallende Stromüberschüsse. Wenn der Wind bläst und die Sonne vom Himmel brennt, werden die Speicher gefüllt. Die gespeicherte Energie kann dann ins Netz eingespeist werden, wenn die Witterungsbedingungen ungünstig sind. Etabliert sind in diesem Zusammenhang Pumpspeicherkraftwerke. Überschüssiger Strom wird verwendet, Wasser in ein hochgelegenes Speicherbecken zu pumpen. Wird Energie gebraucht, lässt man Wasser in Rohren ins Tal schießen. Die kinetische Energie treibt Turbinen an, die über Generatoren Strom erzeugen. Natürlich lässt sich überschüssige Energie auch in Akkus speichern. Oder man produziert etwa besagten grünen Wasserstoff, indem man mit dem überschüssigen Strom einen sogenannten Elektrolyseur betreibt. Die Wassermoleküle werden in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Der Wasserstoff wird gespeichert. Bei Bedarf verstromt man den Wasserstoff in einem speziellen Wasserstoffkraftwerk oder einer Brennstoffzelle. Da die Energie, die benötigt wird, das Wasser im Elektrolyseur “aufzubrechen“, aus erneuerbaren Energiequellen kommt, ist das Verfahren CO2-neutral. Strom wird also benötigt, um Wasserstoff herzustellen, der später genutzt wird, um wieder Strom zu erhalten. In dieser Prozesskette gehen heute etwa 60% Prozent der eingespeisten Energie verloren.
Jetzt stellen sich im Zusammenhang mit der politisch angestrebten Lösung eines volatilen Wasserstoffspeichers einige Fragen. Wie groß müsste dessen Kapazität sein? Was würde er kosten? Und ist Wasserstoff die optimale Lösung? Oder gäbe es Alternativen?
Um zu verstehen, dass die Frage nach der Kapazität der Speicherarchitektur delikat ist, müssen wir kurz überlegen, was passieren würde, wenn der Bedarf an Energie nicht mehr aus den Speichern gedeckt werden könnte. Dann bestünde die Möglichkeit eines Black-Out. Der hätte fatale Konsequenzen. Wenn der Strom nicht fließt, kann Trinkwasser nicht zum Verbraucher gepumpt werden. Abwässer fließen nicht ab. In Märkten mit elektronischen Kassen lässt sich nichts mehr einkaufen. Waren verderben, da die Kühlketten nicht mehr funktionieren. Fahrzeuge können nicht mehr betankt werden. Und nach wenigen Tagen lassen sich Handys nicht mehr verwenden. Die komplette Kommunikationsinfrastruktur bricht zusammen.
Wie groß müsste die Kapazität eines volatilen Speichers sein, um diesen Alptraum unter allen Umständen zu vermeiden? Die Antwort ist schwierig. Eigentlich müsste man tief in eine Kristallkugel schauen können, um in der Zukunft jede Form von Unwägbarkeit auszuschließen. Das Wetter ist chaotisch. Die Speicher füllen sich recht erratisch. Im Gegensatz dazu leeren sie sich planbar in Abhängigkeit vom Bedarf. Wie stellt man sicher, dass sich dieser Bedarf immer decken lässt?
Würde es reichen, sich die Dynamik des Wetters in den letzten paar Jahrzehnten anzuschauen? Dann macht man eine Modellrechnung und multipliziert die ermittelte notwendige Kapazität etwa mit dem Faktor drei und wähnt sich auf der sicheren Seite? Eine solche Vorgehensweise wäre riskant, da der analysierte Zeitraum für repräsentativ gehalten wird. Das könnte ein Irrglaube sein. Hier nur ein Beispiel:
Im April des Jahres 1815 gab es auf der fernen indonesischen Insel Sumbawa einen verheerenden Vulkanausbruch. Als der Tambora explodierte, forderte diese Katastrophe 100000 Menschenleben. Da die Kommunikationsstruktur mit der heutigen nicht vergleichbar war, blieb der Ausbruch zuerst eine kaum wahrgenommene Katastrophe am “Ende der Welt“. Aber das sollte nicht lange so bleiben. 1816 folgte das berüchtigte “Jahr ohne Sommer“. Die bei der Eruption in die Stratosphäre geschossenen Schwefelverbindungen hatten sich nämlich über den Globus ausgebreitet und veränderten nun massiv das Wetter. Selbst im Hochsommer wurde es schon nachmittags dunkel und es regnete die ganze Zeit. Den ersten Schnee gab es im August. Die Folge waren miserable Ernten, denen fürchterliche Hungersnöte folgten.
Ist ein solcher Ausbruch heute gänzlich unwahrscheinlich? Oder wäre es ein Gebot der Klugheit, eine solche Möglichkeit mit ins Kalkül zu ziehen? Tatsächlich hielten Vulkanologen solche Ereignisse bisher für selten. Dem widersprechen neueste Studien. Der Forscher Michael Sigl von der Universität Bern wertete mit Kollegen akribisch Eisbohrkerne aus, die wie ein Klimagedächtnis funktionieren. Die Ergebnisse müssen uns zu denken geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten dreißig Jahren eine vergleichbare Katastrophe erleben könnten, liegt bei 6 Prozent! Haben Sie beim Würfeln schon einmal zwei Sechsen hintereinander geworfen? Bestimmt. Die Wahrscheinlichkeit eines verheerenden Ausbruchs ist mehr als doppelt so groß! Verständlich, dass Vulkanologen darauf drängen, sich mit solchen Szenarien auseinanderzusetzen. Gehör finden sie bislang nicht.
Eine so große Wahrscheinlichkeit bei der Energieplanung zu vernachlässigen, könnte verhängnisvoll sein. Sind wir vor diesem Hintergrund gut beraten, uns nur auf volatile Speicher zu verlassen? Vernünftig wäre es wohl eher, volatile und nicht-volatile Speicher gemeinsam zu nutzen, wobei dann die Frage beantwortet werden muss, wie die nicht-volatilen Speicher möglichst CO2-neutral betrieben werden könnten.
Unabhängig von der existentiellen Forderung, eine Speicherarchitektur zu schaffen, die elastisch auf verschiedenste Herausforderungen reagieren kann, müssen wir jetzt erneut die Frage nach der Effizienz stellen. Diesmal sollen allerdings die wahrscheinlichen Kosten der geplanten Wasserstoffpeicher mit berücksichtigt werden. Was würde eine komplexe Infrastruktur aus Windrädern, Solarmodulen, Elektrolyseuren, Wasserstoffspeichern, Wasserstoffkraftwerken, Brennstoffzellen und Leitungen wohl kosten? In diesem Zusammenhang gibt es ein Problem: Viele Pilotanlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff befinden sich noch in der Erprobungsphase. Deren bisherige Kapazitäten müssten aber um mehrere Zehnerpotenzen vergrößert werden, um den ehrgeizigen Plänen zu genügen! Was das kosten würde, lässt sich im Moment kaum seriös abschätzen. Deshalb müssen wir über den Daumen peilen. Dazu kann man sich in einem ersten Schritt an einer Technologie orientieren, deren Preise bekannt sind. Das gilt etwa für die Akkutechnologie. Wollte man eine Speicherarchitektur von ungefähr 100 Terawattstunden Kapazität bauen, eine solche Größenordnung wird von einigen Experten für sinnvoll gehalten, und würde man dann Akkuspeicher zu den gängigen Marktpreisen verwenden, käme man auf die unvorstellbare Summe von rund 50 Billionen Euro! Selbst wenn die Wasserstoffarchitektur deutlich billiger wäre, handelt es sich hier ohne Frage um eine Multi-Billionen-Euro Investition! Wie soll man das finanzieren? Vor allen Dingen in 12 Jahren, so wie es Luisa Neubauer vorschwebt.
Gemessen an der Zielsetzung Geldmittel effizient einzusetzen, um einen größtmöglichen ökologischen Nutzen zu generieren, darf man deshalb Sinn und Zweck der deutschen Energiewende in Zweifel ziehen. Die Maßnahmen sind extrem teuer und es stellt sich die Frage, ob sich das Geld nicht sinnvoller einsetzen ließe. Die ökologische Kosten/Nutzen-Rechnung überzeugt bisher nicht.
Vor diesem Hintergrund ist es schwer verständlich, warum mit einer gewissen Starrsinn der eingeschlagene Weg weiter beschritten wird.
Warum kapriziert man sich etwa auf den im Umgang komplizierten Wasserstoff? Dieser diffundiert in Leitungen und Speicherbehälter, die mit der Zeit brüchig werden können. Außerdem muss Wasserstoff, damit man ihn handhaben kann, in vielen Anwendungen gekühlt werden und unter großem Druck stehen. Nicht unwesentliche Teile der vorhandenen Infrastruktur müssten deshalb neu gebaut werden, um mit diesem Gas umgehen zu können. Warum macht man das? Weshalb wird nicht mit derselben Intensität auch über Lösungen nachgedacht, die die bereits vorhandene Infrastruktur in größerem Umfang nutzen könnten, um dann mit geringerem finanziellen Einsatz zum Ziel zu kommen?
Um nur ein Beispiel zu nennen: der verstorbene Chemienobelpreisträger George Olah sprach sich dezidiert gegen die Verwendung von Wasserstoff aus. Er plädierte eindringlich für das viel einfacher zu handhabende Methanol, das sich gleichfalls klimaneutral herstellen lässt. Mit Methanol können Autos genauso betrieben werden wie Heizungen, wenn sie mit recht geringem Aufwand angepasst werden. Große Teile der vorhandenen Infrastruktur werden nicht überflüssig, sie könnten weiter verwendet werden. Da stellt sich die Frage, warum es in Deutschland nicht zu einem offenen Wettstreit der Ideen kommt, damit wir gemeinsam die beste Lösung finden?
Haben wir bis hierher vor allen Dingen über die Energiewende in Deutschland nachgedacht, müssen wir nun noch einmal auf das zentrale Problem zu sprechen kommen: Was tun wir eigentlich, um den globalen Klimawandel zu bekämpfen?
Konsequent zu Ende gedacht, müsste eine so komplexe Infrastruktur, wie wir sie gerade für Deutschland beschrieben haben, ja auch auch in Ländern wie Nigeria, dem Sudan oder Indien gebaut werden. Denn genau dort begegnen wir in wenigen Jahren den maßgeblichen Herausforderungen. Aber ist es realistisch, dass dort in kurzer Zeit Parks aus Sonnenkollektoren und Windrädern errichtet werden, wobei es gleichzeitig Leitungsnetze gibt, die die Stromversorgung überall sicher stellen und zudem noch potente Speichersysteme installiert werden, die die überlebensnotwendige Versorgungssicherheit gewährleisten? Das klingt doch recht utopisch. Eher besteht die Gefahr, dass der gewaltige Energiehunger solcher Länder durch Verfeuerung billiger fossiler Brennstoffe gestillt werden wird. Dafür würden mit recht großer Wahrscheinlichkeit tausende Kraftwerke gebaut werden, während wir uns in Deutschland in der Rolle gefallen, für sehr viel Geld einige wenige abzuschalten.
Das ist paradox, wenn man das Klimaproblem ernst nimmt.
Um ein Bild zu gebrauchen: Gesetzt den Fall, ein großes Bauernhaus mit Stall und Scheune steht in Flammen, dann schicken wir den Großteil der Feuerwehrleute in den Garten, um den Geräteschuppen zu löschen, während sich am Haupthaus nur einige wenige mit einer Eimerkette versuchen.
Warum handeln wir so inkonsequent? Damit sind wir wieder am Anfang. Es ist etwas anderes, sich ökologisch zu fühlen, als ökologisch zu handeln. Das erste gibt einem das angenehme Gefühl, die richtigen Ziele zu verfolgen, birgt aber die große Gefahr, der Komplexität des Themas nicht gerecht zu werden. Doch wenn wir das Klimaproblem effizient lösen wollen, haben wir keine andere Wahl, als dicke Bretter zu bohren.
Aus diesem Grund muss die gesamte Energiewende gedanklich aufgeschnürt werden. Es muss alles auf den Prüfstand und es muss ohne Denkverbote mit offenem Visier ausdauernd diskutiert, probiert und getestet werden. In diesem kreativen Wettstreit sollte der Rat von Spezialisten in den Medien mindestens so oft gehört werden, wie der omnipräsenter Talkshow-Berühmtheiten.
Die in Deutschland präferierten regenerativen Energien, Wasserstoff als Speichermedium, die einseitige Favoritisierung der E-Mobilität, wären in diesem Tableau nur Wahlmöglichkeiten unter vielen. Alle Optionen müssen durchdacht werden und in dem Bewusstsein diskutiert werden, dass der Klimawandel ein Problem ist, das den gesamten Planeten Erde betrifft und nicht nur unser Land.
In diesem Zusammenhang wäre mit Nachdruck zu prüfen, wie der wirksame Emissionszertifikatehandel global ausgeweitet werden könnte. Als nächstes müssten die ärmeren Länder im Kampf um die Klimaerwärmung mit ins Boot geholt werden, um sie bei dem Ziel zu unterstützen, einen menschenwürdigen Wohlstand zu entwickeln. Das ist zum einen aus humanitären Gründen geboten. Es wäre aber auch ein wesentlicher Teil der Lösung des CO2-Problems. Gerade arme Länder haben eine rasante Bevölkerungsentwicklung. Kinder sind dort die einzige Form der Altersabsicherung. Es ist aber eine demographische Tatsache, dass Frauen mit wachsendem Wohlstand weniger Kinder bekommen. Und weniger Menschen benötigen weniger Energie. Die Unterstützung dieser Länder darf allerdings nicht darin bestehen, einfach ein Füllhorn mit Geld auszuschütten, das dann, wie leider schon öfter erlebt, von Regierungskasten privatisiert wird. Klüger wäre es, gemeinsam win-win-Situationen zu schaffen, zum Beispiel in Staaten, die hervorragende klimatische Bedingungen haben, in denen aber gleichzeitig verlässliche Verwaltungsstrukturen bestehen und Parlamente demokratisch legitimiert sind. Für diesen Ansatz spräche unter ökologischen Gesichtspunkten nicht nur, dass dort etwa die Nutzung der Sonnenenergie wesentlich effizienter wäre. Würde man diese Energie im nächsten Schritt verwenden, um CO2-neutrale Kraftstoffe in großem Maßstab herzustellen, dann wären diese mit bewährter Technologie einfach zu transportieren und es gäbe in den europäischen Ländern schon eine komplett entwickelte Infrastruktur, um diese zu verwenden. Und die Erzeugerländer würden natürlich auch selbst von der Energie partizipieren
Man wundert sich, warum solche Denkansätze nicht mit Nachdruck verfolgt werden, auch wenn noch viele Fragen zu klären sind. Warum agieren wir immer noch national und so wenig effizient? Warum versäumen wir, einen wirklich wichtigen und global orientierten Beitrag zur Lösung des Klimaproblems zu leisten? Das sind Fragen, die auf eine Antwort warten.
Dr. Marco Wehr ist Physiker und Philosoph. Er arbeitet als Schriftsteller und Redner. Zudem ist Marco Wehr Gründer und Leiter des Philosophischen Labors in Tübingen (www.philab.de)